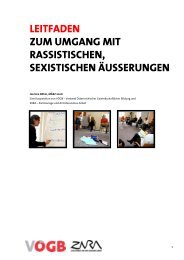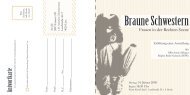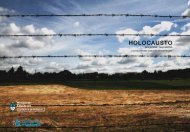GESCHICHTESPAZIERGANG „Auf den Spuren jüdischen ... - Erinnern
GESCHICHTESPAZIERGANG „Auf den Spuren jüdischen ... - Erinnern
GESCHICHTESPAZIERGANG „Auf den Spuren jüdischen ... - Erinnern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.7.3 Ideen zur Gestaltung der Station<br />
Da es sich bei der Neulerchenfelderstraße um eine sehr laute Straße handelt, würde<br />
ich nach dem Besuch der Thelemanngasse („Ewigkeitsgasse“) wieder zu <strong>den</strong><br />
Bänken am Yppenplatz zurückkehren und dort die Biographie von Ernst bzw. Theo<br />
Waldinger kurz erzählen lassen.<br />
Was Ernst betrifft, können Gedichte je nach Interesse der Schüler (manche eher mit<br />
Lokalkolorit, manche eher ernster mit Holocaust-Bezug, siehe Materialanhang 5.7.3)<br />
vorgelesen wer<strong>den</strong>. Die Beschäftigung mit <strong>den</strong> Gedichten könnte aber genauso gut<br />
als Vor- bzw. Nacharbeit in der Schule (am besten im Deutsch-Unterricht) angelegt<br />
wer<strong>den</strong>.<br />
Was Theo Waldinger betrifft, könnten neben einem kurzem Eingehen auf sein Leben<br />
Passagen aus seinem Buch „Zwischen Ottakring und Chicago“ vorgelesen wer<strong>den</strong>:<br />
Im Anhang (5.7.4) befin<strong>den</strong> sich Stellen zur Einwanderung seines Vaters nach Wien<br />
(„Die Liebe zu Wien“), welche auch einen Bezug zum Bethaus in der<br />
Thelemanngasse 8 bieten (Familie Mandelbaum).<br />
„Die Hauptsorge jüdischer Eltern, deren Kinder in die Welt zogen, war damals, dass sie in<br />
der Ferne von <strong>den</strong> alten Traditionen abweichen und vielleicht in ihrem Glauben erschüttert<br />
wer<strong>den</strong> könnten. Als Blume eine orthodoxe Familie gefun<strong>den</strong> hatte, die bereit war, meinen<br />
Vater bei sich aufzunehmen, und als dieser hinreichend glaubwürdig versprochen hatte, fest<br />
nach <strong>den</strong> alten Riten zu leben, durfte er daher tatsächlich aus Boryslaw nach Wien<br />
übersiedeln; und er hielt sich, von unbedeuten<strong>den</strong> Einschränkungen abgesehen, bis ans<br />
Ende seiner Tage an das Versprechen, das er mit vierzehn Jahren seine glaubensstrengen<br />
Mutter gegeben hatte.<br />
Julius Kruppnik, das Oberhaupt der Familie, in die mein Vater geriet, war ultraorthodox, aber<br />
äußerst geschäftstüchtig. Er hatte ein Damenkonfektionsgeschäft aufgebaut und wusste, wie<br />
er die Sabbatruhe umgehen konnte. Gläubige Ju<strong>den</strong> dürfen ja bekanntlich samstags kein<br />
Geschäft offen halten, auch kein Bargeld besitzen. Der Samstag war andrerseits aber der<br />
Hauptgeschäftstag, und so verkaufte Julius Kruppnik je<strong>den</strong> Freitag am Abend, wenn der<br />
Sabbat beginnt, bis zum Samstagabend, wenn er endet, sein Geschäft um einen nominalen<br />
Betrag an einen Nichtju<strong>den</strong>. So gingen die Geschäfte gut und er blieb doch sün<strong>den</strong>frei und<br />
lebte ganz nach dem Buchstaben der Gesetze. Von dem Reichtum, <strong>den</strong> er so schuf und<br />
mehrte, verwandte Julius Kruppnik hohe Summen freigebig für soziale und religiöse<br />
Belange. Unter anderem war er die finanzielle Stütze des Bethausvereins Gemiluth Chesed<br />
Haus der Gnade). Das Gebäude dieses Vereins in der Telemanngase im 16. Bezirk gehörte<br />
einer Familie Mandelbaum, die im Holocaust nahezu ausgelöscht wurde; einem Sohn des<br />
Vermieters Mandelbaum aber sollte die Flucht aus Euro gelingen – er änderte seinen Namen<br />
in New York auf Frederic Morton und wurde ein angesehener amerikanischer Schriftsteller.“ 71<br />
66