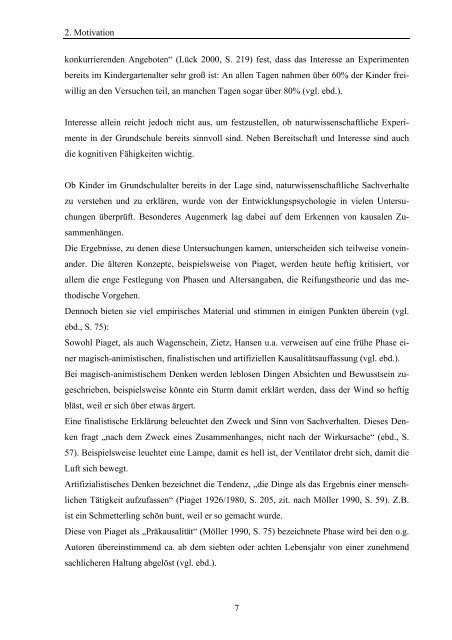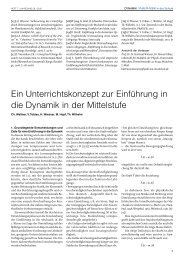Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Motivation<br />
konkurrierenden Angeboten“ (Lück 2000, S. 219) fest, dass das Interesse an Experimenten<br />
bereits im Kindergartenalter sehr groß ist: An allen Tagen nahmen über 60% der Kinder freiwillig<br />
an den Versuchen teil, an manchen Tagen sogar über 80% (vgl. ebd.).<br />
Interesse allein reicht jedoch nicht aus, um festzustellen, ob naturwissenschaftliche Experimente<br />
in der Grundschule bereits sinnvoll sind. Neben Bereitschaft und Interesse sind auch<br />
die kognitiven Fähigkeiten wichtig.<br />
Ob Kinder im Grundschulalter bereits in der Lage sind, naturwissenschaftliche Sachverhalte<br />
zu verstehen und zu erklären, wurde von der Entwicklungspsychologie in vielen Untersuchungen<br />
überprüft. Besonderes Augenmerk lag dabei auf dem Erkennen von kausalen Zusammenhängen.<br />
Die Ergebnisse, zu denen diese Untersuchungen kamen, unterscheiden sich teilweise voneinander.<br />
Die älteren Konzepte, beispielsweise von Piaget, werden heute heftig kritisiert, vor<br />
allem die enge Festlegung von Phasen und Altersangaben, die Reifungstheorie und das methodische<br />
Vorgehen.<br />
Dennoch bieten sie viel empirisches Material und stimmen in einigen Punkten überein (vgl.<br />
ebd., S. 75):<br />
Sowohl Piaget, <strong>als</strong> auch Wagenschein, Zietz, Hansen u.a. verweisen auf eine frühe Phase einer<br />
magisch-animistischen, finalistischen und artifiziellen Kausalitätsauffassung (vgl. ebd.).<br />
Bei magisch-animistischem Denken werden leblosen Dingen Absichten und Bewusstsein zugeschrieben,<br />
beispielsweise könnte ein Sturm damit erklärt werden, dass der Wind so heftig<br />
bläst, weil er sich über etwas ärgert.<br />
Eine finalistische Erklärung beleuchtet den Zweck und Sinn von Sachverhalten. Dieses Denken<br />
fragt „nach dem Zweck eines Zusammenhanges, nicht nach der Wirkursache“ (ebd., S.<br />
57). Beispielsweise leuchtet eine Lampe, damit es hell ist, der Ventilator dreht sich, damit die<br />
Luft sich bewegt.<br />
Artifizialistisches Denken bezeichnet die Tendenz, „die Dinge <strong>als</strong> das Ergebnis einer menschlichen<br />
Tätigkeit aufzufassen“ (Piaget 1926/1980, S. 205, zit. nach Möller 1990, S. 59). Z.B.<br />
ist ein Schmetterling schön bunt, weil er so gemacht wurde.<br />
Diese von Piaget <strong>als</strong> „Präkausalität“ (Möller 1990, S. 75) bezeichnete Phase wird bei den o.g.<br />
Autoren übereinstimmend ca. ab dem siebten oder achten Lebensjahr von einer zunehmend<br />
sachlicheren Haltung abgelöst (vgl. ebd.).<br />
7