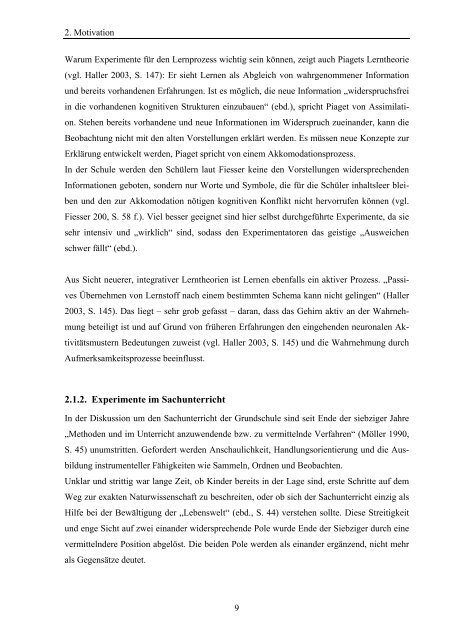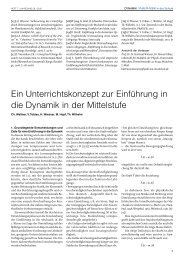Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Download als pdf, 1,5 MB - Prof. Dr. Thomas Wilhelm
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2. Motivation<br />
Warum Experimente für den Lernprozess wichtig sein können, zeigt auch Piagets Lerntheorie<br />
(vgl. Haller 2003, S. 147): Er sieht Lernen <strong>als</strong> Abgleich von wahrgenommener Information<br />
und bereits vorhandenen Erfahrungen. Ist es möglich, die neue Information „widerspruchsfrei<br />
in die vorhandenen kognitiven Strukturen einzubauen“ (ebd.), spricht Piaget von Assimilation.<br />
Stehen bereits vorhandene und neue Informationen im Widerspruch zueinander, kann die<br />
Beobachtung nicht mit den alten Vorstellungen erklärt werden. Es müssen neue Konzepte zur<br />
Erklärung entwickelt werden, Piaget spricht von einem Akkomodationsprozess.<br />
In der Schule werden den Schülern laut Fiesser keine den Vorstellungen widersprechenden<br />
Informationen geboten, sondern nur Worte und Symbole, die für die Schüler inhaltsleer bleiben<br />
und den zur Akkomodation nötigen kognitiven Konflikt nicht hervorrufen können (vgl.<br />
Fiesser 200, S. 58 f.). Viel besser geeignet sind hier selbst durchgeführte Experimente, da sie<br />
sehr intensiv und „wirklich“ sind, sodass den Experimentatoren das geistige „Ausweichen<br />
schwer fällt“ (ebd.).<br />
Aus Sicht neuerer, integrativer Lerntheorien ist Lernen ebenfalls ein aktiver Prozess. „Passives<br />
Übernehmen von Lernstoff nach einem bestimmten Schema kann nicht gelingen“ (Haller<br />
2003, S. 145). Das liegt – sehr grob gefasst – daran, dass das Gehirn aktiv an der Wahrnehmung<br />
beteiligt ist und auf Grund von früheren Erfahrungen den eingehenden neuronalen Aktivitätsmustern<br />
Bedeutungen zuweist (vgl. Haller 2003, S. 145) und die Wahrnehmung durch<br />
Aufmerksamkeitsprozesse beeinflusst.<br />
2.1.2. Experimente im Sachunterricht<br />
In der Diskussion um den Sachunterricht der Grundschule sind seit Ende der siebziger Jahre<br />
„Methoden und im Unterricht anzuwendende bzw. zu vermittelnde Verfahren“ (Möller 1990,<br />
S. 45) unumstritten. Gefordert werden Anschaulichkeit, Handlungsorientierung und die Ausbildung<br />
instrumenteller Fähigkeiten wie Sammeln, Ordnen und Beobachten.<br />
Unklar und strittig war lange Zeit, ob Kinder bereits in der Lage sind, erste Schritte auf dem<br />
Weg zur exakten Naturwissenschaft zu beschreiten, oder ob sich der Sachunterricht einzig <strong>als</strong><br />
Hilfe bei der Bewältigung der „Lebenswelt“ (ebd., S. 44) verstehen sollte. Diese Streitigkeit<br />
und enge Sicht auf zwei einander widersprechende Pole wurde Ende der Siebziger durch eine<br />
vermittelndere Position abgelöst. Die beiden Pole werden <strong>als</strong> einander ergänzend, nicht mehr<br />
<strong>als</strong> Gegensätze deutet.<br />
9