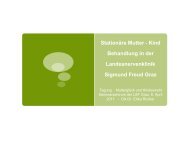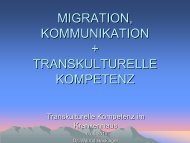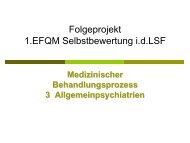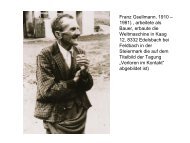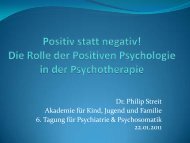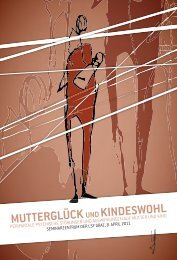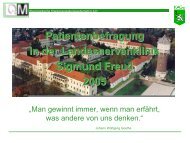Sprachliche Konstruktion von Geschlechtlichkeit in der ... - LSF Graz
Sprachliche Konstruktion von Geschlechtlichkeit in der ... - LSF Graz
Sprachliche Konstruktion von Geschlechtlichkeit in der ... - LSF Graz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Schon durch den Begriff ‚do<strong>in</strong>g’ alle<strong>in</strong>e werden „kulturelle Inszenierungspraktiken“<br />
und nicht biologische Gegebenheiten <strong>in</strong>s Zentrum <strong>der</strong> Aufmerksamkeit<br />
gerückt. „Wer sich mit "do<strong>in</strong>g gen<strong>der</strong>" beschäftigt, will beschreiben, wie sich Menschen<br />
performativ als männlich o<strong>der</strong> weiblich zu erkennen geben und mittels welcher<br />
Verfahren das so gestaltete kulturelle Geschlecht im Alltag relevant gesetzt<br />
wird“ (Kothoff 2002). Wie schon an an<strong>der</strong>en Stellen <strong>in</strong> dieser Arbeit erwähnt, wird<br />
<strong>Geschlechtlichkeit</strong> durch Interaktion mit an<strong>der</strong>en Menschen konstruiert. E<strong>in</strong> wichtiger<br />
Punkt hierbei ist die Arbeit, <strong>der</strong> Menschen nachgehen. So wurde <strong>der</strong> enge<br />
Zusammenhang zwischen Arbeit und Geschlechterkonstruktion schon 1975 <strong>von</strong> Gayle<br />
Rub<strong>in</strong> folgen<strong>der</strong>maßen beschrieben:<br />
„The division of labour by sex can (…) be seen as a taboo: a taboo aga<strong>in</strong>st<br />
the sameness of men and women, a taboo divid<strong>in</strong>g the sexes <strong>in</strong>to two<br />
mutually exclusive categories, a taboo (…) that creates gen<strong>der</strong>.” (Rub<strong>in</strong><br />
1975, 178)<br />
Die geschlechtliche Arbeitsteilung an sich kann also bereits als <strong>Konstruktion</strong>smedium<br />
<strong>von</strong> Gen<strong>der</strong> gesehen werden. Geht man nun da<strong>von</strong> aus, dass auch Arbeit an sich e<strong>in</strong><br />
Produkt verschiedener <strong>Konstruktion</strong>smechanismen ist, so erklärt man damit den Begriff<br />
‚Do<strong>in</strong>g work’. Analog zu ‚do<strong>in</strong>g gen<strong>der</strong>’ werden auch Arbeitsbereiche über Interaktion<br />
konstruiert.<br />
„Untersuchungen zum beruflichen Alltagshandeln gehen <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Grundüberlegung aus, dass die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern<br />
e<strong>in</strong>e <strong>der</strong> zentralen „ressources of do<strong>in</strong>g gen<strong>der</strong>“ […] darstellen. Sie fragen<br />
danach, wie im Zuge des beruflichen Alltagshandelns immer auch<br />
Geschlecht sozial konstruiert und <strong>in</strong>folgedessen die Geschlechterdifferenz<br />
immer neu zu e<strong>in</strong>er normalen und „natürlichen“ Selbstverständlichkeit<br />
wird. Sie versuchen also […] zu zeigen, wie „do<strong>in</strong>g gen<strong>der</strong>“ und „do<strong>in</strong>g<br />
work“ <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong>greifen und wie im „do<strong>in</strong>g work“ stets auch etwas an<strong>der</strong>es<br />
als ‚nur’ e<strong>in</strong> Arbeitsprodukt hergestellt wird: die Geschlechtszugehörigkeit<br />
<strong>der</strong> beteiligten Akteure und – vermittelt darüber – das Geschlecht <strong>der</strong><br />
Arbeit, die sie tun.“ (Wetterer 2002, S. 130)<br />
52