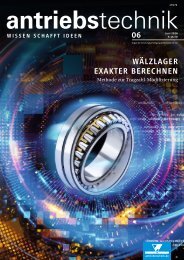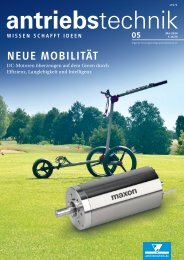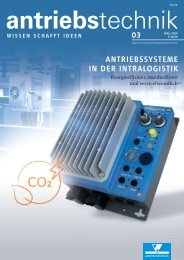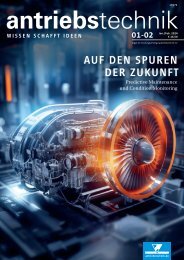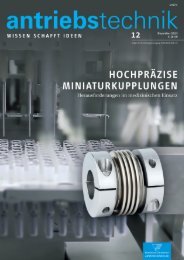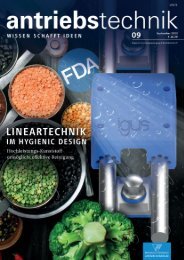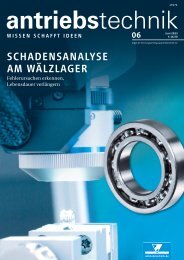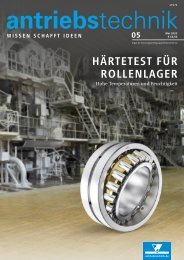antriebstechnikk 3/2016
antriebstechnik 3/2016
antriebstechnik 3/2016
- TAGS
- antriebstechnik
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MEHRMOTORENANTRIEBSSYSTEME<br />
sentieren sowohl die Ergebnisse mehrjähriger Forschungsaktivitäten<br />
als auch einen Überblick über den aktuellen Stand und zukünftige<br />
Ziele der Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet.<br />
Aufbau und Struktur<br />
von Mehrmotorenantriebssystemen<br />
Mehrmotorenantriebssysteme sind definiert als die Kombination<br />
von zwei oder mehr Motoren, die gemeinsam einen Arbeitsprozess<br />
antreiben und sich aufgrund ihrer Verkopplung in ihrem Betriebsverhalten<br />
gegenseitig beeinflussen [SHZ14]. Sofern vorhanden, zählen<br />
alle elektrischen, elektronischen und mechanischen Elemente,<br />
die am Leistungsfluss von dem elektrischen Versorgungsnetz bis zu<br />
dem Arbeitsprozess beteiligt sind, zu dem MMDS (Bild 02).<br />
Das Gesamtsystem kann in die folgenden fünf Bereiche untergliedert<br />
werden:<br />
n Das elektrische Versorgungsnetz stellt die Energiequelle – und im<br />
Falle eines rückspeisefähigen Systems ebenfalls die Energiesenke<br />
– des MMDS dar.<br />
n Der Bereich der Elektronik umfasst alle Elemente, die die von<br />
dem elektrischen Versorgungsnetz bereitgestellte Energie transformieren<br />
sowie die Komponenten der Datenverarbeitung und<br />
der Regelung. Es können sowohl Einzelumrichter für jeden Motor<br />
als auch modulare Frequenzumrichterbaureihen aus getrennten<br />
Gleichrichter- und Wechselrichtermodulen verwendet werden.<br />
Die Datenverarbeitung und die Regelung werden durch eine SPS,<br />
eine Soft-SPS, ein übergeordnetes Computersystem oder eine<br />
Kombination dieser Komponenten übernommen.<br />
n Die Motoren können elektrische Maschinen beliebiger Bauweise<br />
und beliebiger Leistungsklasse sein. Innerhalb eines MMDS können<br />
unterschiedliche Maschinenbauweisen und Leistungsklassen<br />
miteinander kombiniert werden.<br />
n Das mechanische Übertragungsglied verkoppelt die Motoren des<br />
MMDS miteinander. Dabei ist zu beachten, dass dieses nicht<br />
zwangsläufig als Getriebe ausgeführt sein muss.<br />
n Der Arbeitsprozess wird von dem MMDS angetrieben. Im allgemeinen<br />
Fall wird es sich um einen leistungsvariablen Arbeitsprozess<br />
handeln, bei dem während der Prozesszeit sowohl Drehmoment als<br />
auch Drehzahl variieren.<br />
In Abhängigkeit des mechanischen Übertragungsgliedes lassen<br />
sich die drei Verkopplungsarten<br />
n mechanisch starre Kopplung,<br />
n mechanisch elastische Kopplung und<br />
n technologische Kopplung<br />
unterscheiden [SHZ14; JBM06]. Eine mechanisch starre Kopplung<br />
liegt vor, wenn eine Approximation der gegenseitigen Beeinflussung<br />
der Motoren durch ein reines Proportionalverhalten möglich<br />
ist. Bei einer mechanisch elastischen Kopplung hingegen muss die<br />
gegenseitige Beeinflussung der Motoren durch ein ausgeprägtes<br />
PT n<br />
-Verhalten (Proportionalverhalten mit Verzögerungsanteil n-ter<br />
Ordnung) berücksichtigt werden. Eine technologische Kopplung<br />
wiederum liegt dann vor, wenn keine direkte mechanische Beeinflussung<br />
der Motoren stattfindet, sondern eine Kopplung auf informationeller<br />
Ebene existiert, wie sie z. B. bei Gelenkarmrobotern mit<br />
einem Motor je Bewegungsachse auftritt.<br />
Aufgrund dieser Definition gibt es viele unterschiedliche Ausprägungen<br />
von MMDS, die für verschiedenste Arbeitsprozesse geeignet<br />
sind. Häufig wird das mechanische Übertragungsglied ein Summa-<br />
02 Schematische Struktur eines allgemeinen MMDS<br />
tionsgetriebe sein, womit eine mechanisch starre Kopplung der<br />
Motoren vorliegt. Weiterhin werden für viele industrielle Arbeitsprozesse<br />
vornehmlich Asynchronmaschinen verwendet werden.<br />
Dieser Antriebssystemaufbau wird den Großteil der industriellen<br />
Anwendungen abdecken. Daher liegt der Fokus dieser Beitragsreihe<br />
auf derartigen Systemen.<br />
Systeminhärente Freiheitsgrade<br />
Aufgrund ihrer Struktur besitzen MMDS gegenüber SMDS erweiterte<br />
systeminhärente Freiheitsgrade, die sowohl während der<br />
Konzeptionsphase als auch während des Betriebs berücksichtigt<br />
werden müssen. Die Freiheitsgrade in der Konzeptionsphase betreffen<br />
hauptsächlich die Auswahl der zu verwendenden Komponenten.<br />
Das folgende Gedankenexperiment soll diese Freiheitsgrade<br />
veranschaulichen.<br />
Plant ein Antriebstechnikhersteller eine neue Antriebssystembaureihe<br />
mit den Nennleistungen 1 x P n<br />
und 2 x P n<br />
, so sieht das<br />
konventionelle Vorgehen für die Konzeption einer SMDS-Baureihe<br />
die Auswahl von zwei Motoren entsprechender Nennleistungen,<br />
die Auswahl der motorspezifischen Leistungselektronik und die<br />
Konzeption von zwei Getrieben vor.<br />
Wird dieselbe Baureihe hingegen unter Berücksichtigung eines<br />
MMDS-Konzeptes geplant, so werden während der Konzeptionsphase<br />
ein Motor der Nennleistung 1 x P n<br />
und ein entsprechender<br />
Frequenzumrichter ausgewählt. Zusätzlich wird ein Getriebe konzipiert,<br />
welches in zwei Varianten – mit einer oder mit zwei Eingangswellen<br />
– gefertigt werden kann (Bild 03). Die Eingangswellen<br />
und die Ausgangswelle sind dabei für beide Getriebevarianten<br />
identisch. Über das gesamte Produktportfolio hinweg muss durch<br />
eine geeignet gewählte Stufung der Baureihen sichergestellt werden,<br />
dass modularitätsbedingte Überdimensionierungen mechanischer<br />
Bauteile in möglichst geringem Umfang auftreten.<br />
Beide Ansätze sind in der Lage, die geforderte externe Variantenvielfalt<br />
bereitzustellen. Es ist allerdings ersichtlich, dass bei Verwendung<br />
des MMDS-Konzeptes eine geringere interne Variantenvielfalt<br />
und ein höherer Gleichteilegrad innerhalb der Baureihe entstehen.<br />
Hieraus resultieren für den Antriebstechnikhersteller Kostenvorteile<br />
n im Einkauf aufgrund von Skaleneffekten,<br />
n in der Produktion und Logistik aufgrund von bekannten und<br />
standardisiert handhabbaren Komponenten,<br />
n im Vertrieb durch eine gesteigerte Konfigurationsfähigkeit der<br />
Produkte und eine erhöhte Liefertreue<br />
n sowie in der internen Organisation der Leistungserstellung durch<br />
ein vereinfachtes Produktdatenmanagement.<br />
antriebstechnik 3/<strong>2016</strong> 85