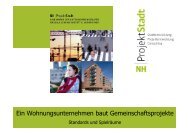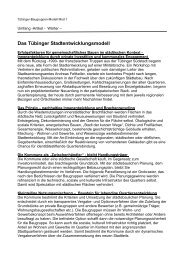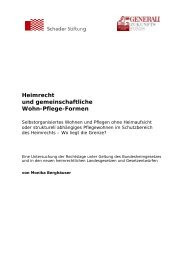Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1. Segregation <strong>und</strong> die <strong>Integration</strong> von Fremden<br />
Städte sind durch Zuwanderung entstanden, <strong>und</strong> nur durch Zuwanderung können sie<br />
ihren Bevölkerungsstand halten. Städte, zumal Großstädte, sind daher charakterisiert<br />
durch das Zusammenleben von Fremden. Die kulturelle <strong>und</strong> soziale Heterogenität der<br />
Bevölkerung ist ein Definitionsmerkmal von Urbanität.<br />
5<br />
Wie dieses Zusammenleben möglichst konfliktfrei organisiert werden kann, ist eine der<br />
Gr<strong>und</strong>fragen der Stadtpolitik. Soll man die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nach<br />
Nationalität, Ethnizität, sozialer Schicht etc. separiert in verschiedenen Quartieren der<br />
Stadt unterbringen oder soll man sie möglichst gleichmäßig über das ganze Stadtgebiet<br />
verteilen - Mischen oder Trennen, das ist die Gretchenfrage von Stadtplanern <strong>und</strong><br />
Stadtpolitikern, wenn es um die Regulierung heterogener Stadtgesellschaften geht.<br />
Diese Frage ist in Deutschland in dem Maße dringlicher geworden, als mit der<br />
Differenzierung von Lebensstilen, den zunehmenden sozialen Spaltungen <strong>und</strong> mit der<br />
Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen Aversionen, Fremdenfeindlichkeit <strong>und</strong><br />
Konflikte zwischen verschiedenen Gruppen wahrscheinlicher geworden sind.<br />
Die folgenden Überlegungen gehen zunächst auf die verschiedenen Lebensweisen in<br />
den Großstädten ein, danach auf die beiden theoretischen Konzepte der <strong>Integration</strong> von<br />
Stadtgesellschaften, die in der Stadtsoziologie entwickelt worden sind. Sie geben<br />
Antworten auf die Frage: wie ist ein friedliches Zusammenleben auf engem Raum<br />
möglich, auch wenn die Bewohner einander fremd sind oder sich gar feindlich<br />
gegenüberstehen?<br />
1.1 Die urbane Lebensweise<br />
In der Tradition von Georg Simmel (1984) gilt die ‚urbane Lebensweise‘ als eine<br />
kulturelle Errungenschaft der Großstadtentwicklung, weil sie eine zwanglose<br />
Koexistenz von einander Fremden auf engem Raum ermöglicht. Nach Simmel stellt das<br />
Zusammenleben von einander Fremden auf engem Raum, wie es für Großstädte typisch<br />
ist, eine explosive Situation dar, in der jederzeit Konflikte ausbrechen könnten, wenn<br />
sich die Menschen nicht stadtspezifische, „urbane“ Verhaltensweisen angewöhnt hätten,<br />
die eine Koexistenz erlauben, ohne – das ist das Entscheidende – daß sich die Menschen<br />
einander anpassen!<br />
1.1.1 Gleichgültigkeit <strong>und</strong> Toleranz als Voraussetzung für Koexistenz<br />
Der Gr<strong>und</strong>gedanke besteht darin, daß jeder Stadtbewohner, unerwünschten Kontakten<br />
mit andersartigen Menschen auszuweichen sucht, weil es anders kaum möglich wäre,<br />
die vielen ungeplanten <strong>und</strong> ungewollten Kontakten <strong>und</strong> Berührungen, denen man in der<br />
dicht bevölkerten Großstadt ausgeliefert ist, innerlich zu verarbeiten. Kontakten kann<br />
man allerdings nicht physisch ausweichen. Der Großstädter baut deshalb eine<br />
Wahrnehmungsbarriere auf: man zieht sich gleichsam ‚nach innen‘ zurück. Man sieht<br />
den anderen, aber man meidet den Kontakt, <strong>und</strong> vor allem: man nimmt ihn als