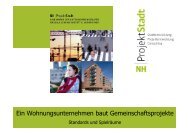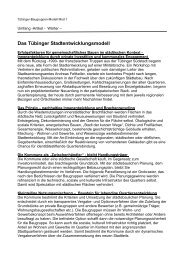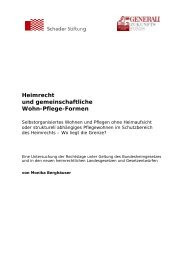Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Soziale Integration und ethnische Schichtung - Schader-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
83<br />
müssen Migranten Gegenleistungen erbringen, mindestens die Akzeptanz der zentralen<br />
Prinzipien der Demokratie. Wir benennen im folgenden einige Stichworte zur<br />
integrationsfördernden Politik (vgl. hierzu auch Krummacher/Waltz 1996).<br />
Die Mehrheitsgesellschaft muß politische <strong>und</strong> soziale Rechte garantieren <strong>und</strong> soziale<br />
Diskriminierungen unterlassen – insbesondere durch Personen, die über<br />
gesellschaftliche Macht verfügen.<br />
Gegen die Informationsdefizite <strong>und</strong> die sprachlichen <strong>und</strong> beruflichen Defizite benötigt<br />
man Beratungs-, Qualifikations-, Fördermaßnahmen, (kollektive) Selbsthilfe,<br />
Vernetzungen als Ressource für Orientierung, Identitätsbildung <strong>und</strong><br />
Interessenvertretung (vgl. Schulte 2000, 68). Daran sind Organisationen von<br />
Ausländern als Träger zu beteiligen. Vor allem solche Organisationen verdienen<br />
Unterstützung, die eine interkulturelle Orientierungen fördern. Für den „bestmöglichen<br />
Umgang mit Minderheiten im städtischen Kontext“ hat Rex (1998) folgenden Katalog<br />
aufgestellt:<br />
1. keine Diskriminierung bei der Wohnraumzuteilung;<br />
2. Toleranz gegenüber Einwanderergebieten, keine Barrieren gegen freiwillige<br />
Segregation aufbauen;<br />
3. Politische Repräsentation aller Minderheiten in städtischen Ämtern;<br />
4. Einrichtung von Konsultationsmechanismen (die Meinungen <strong>und</strong> Bedürfnisse der<br />
Einwanderer kennenlernen);<br />
5. Unterstützung von Minderheitenkulturen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen;<br />
6. Anerkennung des Ideals der Wahlfreiheit (kein Zwang zur Assimilation);<br />
7. Aufmerksamkeit für die besonderen Bedürfnisse <strong>und</strong> Nöte von Schulkindern, damit<br />
keine Benachteiligung bei Bildung <strong>und</strong> Ausbildung entsteht;<br />
8. Religiöse Toleranz gegen Minderheitenreligionen – wie gegen Juden; Unterweisung<br />
in eigener Kultur auf freiwilliger Basis;<br />
9. Assimilations- <strong>und</strong> Akkulturationsprozeß über mehrere Generationen auf<br />
freiwilliger Basis unter Fortführung symbolischer Ethnizitäten;<br />
10. Keine Multikultur, die nur aus einem Amalgam vieler Kulturen besteht, sondern<br />
Mehrheitskultur, die sich allerdings durch Aufnahme von Elementen der<br />
Minderheitenkulturen weiterentwickelt.<br />
Ein Beispiel für eine multikulturelle Stadtpolitik bietet die Stadt Toronto in Kanada, das<br />
als Einwanderungsland günstige Rahmenbedingungen für eine lokale <strong>Integration</strong>spolitik<br />
bietet (vgl. zu Australien McKenzie 1997; vgl. auch Jansen/Baringhorst 1994; Han<br />
2000, 286ff). Seit 1971 gehört ‚Multikultur‘ zum offiziellen Selbstverständnis des<br />
kanadischen Staates. Dazu gehört, daß unter Gleichbehandlung auch verstanden wird,<br />
verschiedene Bevölkerungsgruppen verschieden zu behandeln, also ihre kulturelle