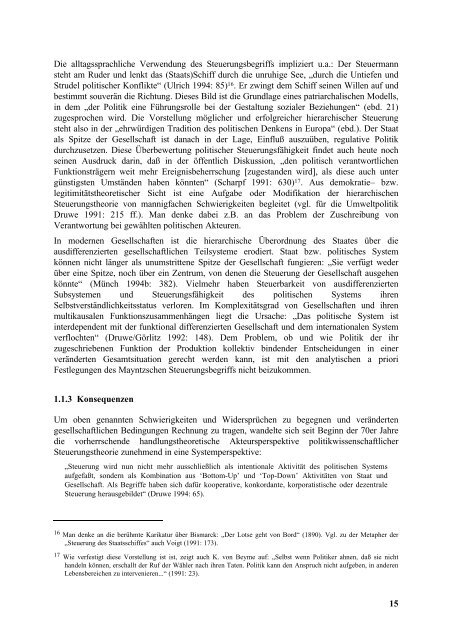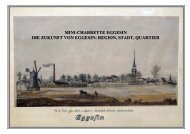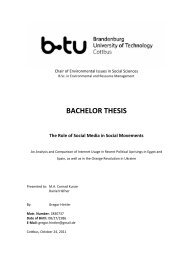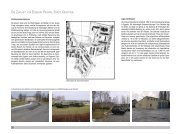Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die alltagssprachliche Verwendung des Steuerungsbegriffs impliziert u.a.: Der Steuermann<br />
steht am Ruder und lenkt das (Staats)Schiff durch die unruhige See, „durch die Untiefen und<br />
Strudel politischer Konflikte“ (Ulrich 1994: 85) 16 . Er zwingt dem Schiff seinen Willen auf und<br />
bestimmt souverän die Richtung. Dieses Bild ist die Grundlage eines patriarchalischen Modells,<br />
in dem „der Politik eine Führungsrolle bei der Gestaltung sozialer Beziehungen“ (ebd. 21)<br />
zugesprochen wird. Die Vorstellung möglicher und erfolgreicher hierarchischer Steuerung<br />
steht also in der „ehrwürdigen Tradition des politischen Denkens in Europa“ (ebd.). Der Staat<br />
als Spitze der Gesellschaft ist danach in der Lage, Einfluß auszuüben, regulative Politik<br />
durchzusetzen. Diese Überbewertung politischer Steuerungsfähigkeit findet auch heute noch<br />
seinen Ausdruck darin, daß in der öffentlich Diskussion, „den politisch verantwortlichen<br />
Funktionsträgern weit mehr Ereignisbeherrschung [zugestanden wird], als diese auch unter<br />
günstigsten Umständen haben könnten“ (Scharpf 1991: 630) 17 . Aus demokratie– bzw.<br />
legitimitätstheoretischer Sicht ist eine Aufgabe oder Modifikation der hierarchischen<br />
Steuerungstheorie von mannigfachen Schwierigkeiten begleitet (vgl. für die Umweltpolitik<br />
Druwe 1991: 215 ff.). Man denke dabei z.B. an das Problem der Zuschreibung von<br />
Verantwortung bei gewählten politischen Akteuren.<br />
In modernen Gesellschaften ist die hierarchische Überordnung des Staates über die<br />
ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsysteme erodiert. Staat bzw. politisches System<br />
können nicht länger als unumstrittene Spitze der Gesellschaft fungieren: „Sie verfügt weder<br />
über eine Spitze, noch über ein Zentrum, von denen die Steuerung der Gesellschaft ausgehen<br />
könnte“ (Münch 1994b: 382). Vielmehr haben Steuerbarkeit von ausdifferenzierten<br />
Subsystemen und Steuerungsfähigkeit des politischen Systems ihren<br />
Selbstverständlichkeitsstatus verloren. Im Komplexitätsgrad von Gesellschaften und ihren<br />
multikausalen Funktionszusammenhängen liegt die Ursache: „Das politische System ist<br />
interdependent mit der funktional differenzierten Gesellschaft und dem internationalen System<br />
verflochten“ (Druwe/Görlitz 1992: 148). Dem Problem, ob und wie Politik der ihr<br />
zugeschriebenen Funktion der Produktion kollektiv bindender Entscheidungen in einer<br />
veränderten Gesamtsituation gerecht werden kann, ist mit den analytischen a priori<br />
Festlegungen des Mayntzschen Steuerungsbegriffs nicht beizukommen.<br />
1.1.3 Konsequenzen<br />
Um oben genannten Schwierigkeiten und Widersprüchen zu begegnen und veränderten<br />
gesellschaftlichen Bedingungen Rechnung zu tragen, wandelte sich seit Beginn der 70er Jahre<br />
die vorherrschende handlungstheoretische Akteursperspektive politikwissenschaftlicher<br />
Steuerungstheorie zunehmend in eine Systemperspektive:<br />
„Steuerung wird nun nicht mehr ausschließlich als intentionale Aktivität des politischen Systems<br />
aufgefaßt, sondern als Kombination aus ‘Bottom-Up’ und ‘Top-Down’ Aktivitäten von Staat und<br />
Gesellschaft. Als Begriffe haben sich dafür kooperative, konkordante, korporatistische oder dezentrale<br />
Steuerung herausgebildet“ (Druwe 1994: 65).<br />
16 Man denke an die berühmte Karikatur über Bismarck: „Der Lotse geht von Bord“ (1890). Vgl. zu der Metapher der<br />
„Steuerung des Staatsschiffes“ auch Voigt (1991: 173).<br />
17 Wie verfestigt diese Vorstellung ist ist, zeigt auch K. von Beyme auf: „Selbst wenn Politiker ahnen, daß sie nicht<br />
handeln können, erschallt der Ruf der Wähler nach ihren Taten. Politik kann den Anspruch nicht aufgeben, in anderen<br />
Lebensbereichen zu intervenieren...“ (1991: 23).<br />
15