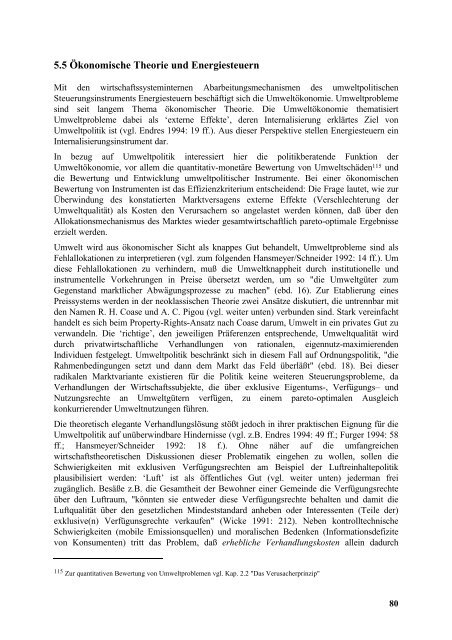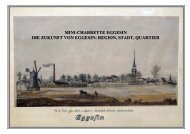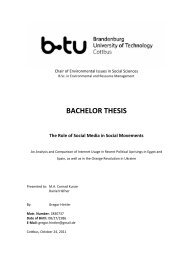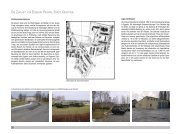Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5.5 Ökonomische Theorie und Energiesteuern<br />
Mit den wirtschaftssysteminternen Abarbeitungsmechanismen des umweltpolitischen<br />
Steuerungsinstruments Energiesteuern beschäftigt sich die Umweltökonomie. Umweltprobleme<br />
sind seit langem Thema ökonomischer Theorie. Die Umweltökonomie thematisiert<br />
Umweltprobleme dabei als ‘externe Effekte’, deren Internalisierung erklärtes Ziel von<br />
Umweltpolitik ist (vgl. Endres 1994: 19 ff.). Aus dieser Perspektive stellen Energiesteuern ein<br />
Internalisierungsinstrument dar.<br />
In bezug auf Umweltpolitik interessiert hier die politikberatende Funktion der<br />
Umweltökonomie, vor allem die quantitativ-monetäre Bewertung von Umweltschäden 115 und<br />
die Bewertung und Entwicklung umweltpolitischer Instrumente. Bei einer ökonomischen<br />
Bewertung von Instrumenten ist das Effizienzkriterium entscheidend: Die Frage lautet, wie zur<br />
Überwindung des konstatierten Marktversagens externe Effekte (Verschlechterung der<br />
Umweltqualität) als Kosten den Verursachern so angelastet werden können, daß über den<br />
Allokationsmechanismus des Marktes wieder gesamtwirtschaftlich pareto-optimale Ergebnisse<br />
erzielt werden.<br />
Umwelt wird aus ökonomischer Sicht als knappes Gut behandelt, Umweltprobleme sind als<br />
Fehlallokationen zu interpretieren (vgl. zum folgenden Hansmeyer/Schneider 1992: 14 ff.). Um<br />
diese Fehlallokationen zu verhindern, muß die Umweltknappheit durch institutionelle und<br />
instrumentelle Vorkehrungen in Preise übersetzt werden, um so "die Umweltgüter zum<br />
Gegenstand marktlicher Abwägungsprozesse zu machen" (ebd. 16). Zur Etablierung eines<br />
Preissystems werden in der neoklassischen Theorie zwei Ansätze diskutiert, die untrennbar mit<br />
den Namen R. H. Coase und A. C. Pigou (vgl. weiter unten) verbunden sind. Stark vereinfacht<br />
handelt es sich beim Property-Rights-Ansatz nach Coase darum, Umwelt in ein privates Gut zu<br />
verwandeln. Die ‘richtige’, den jeweiligen Präferenzen entsprechende, Umweltqualität wird<br />
durch privatwirtschaftliche Verhandlungen von rationalen, eigennutz-maximierenden<br />
Individuen festgelegt. Umweltpolitik beschränkt sich in diesem Fall auf Ordnungspolitik, "die<br />
Rahmenbedingungen setzt und dann dem Markt das Feld überläßt" (ebd. 18). Bei dieser<br />
radikalen Marktvariante existieren für die Politik keine weiteren Steuerungsprobleme, da<br />
Verhandlungen der Wirtschaftssubjekte, die über exklusive Eigentums-, Verfügungs– und<br />
Nutzungsrechte an Umweltgütern verfügen, zu einem pareto-optimalen Ausgleich<br />
konkurrierender Umweltnutzungen führen.<br />
Die theoretisch elegante Verhandlungslösung stößt jedoch in ihrer praktischen Eignung für die<br />
Umweltpolitik auf unüberwindbare Hindernisse (vgl. z.B. Endres 1994: 49 ff.; Furger 1994: 58<br />
ff.; Hansmeyer/Schneider 1992: 18 f.). Ohne näher auf die umfangreichen<br />
wirtschaftstheoretischen Diskussionen dieser Problematik eingehen zu wollen, sollen die<br />
Schwierigkeiten mit exklusiven Verfügungsrechten am Beispiel der Luftreinhaltepolitik<br />
plausibilisiert werden: ‘Luft’ ist als öffentliches Gut (vgl. weiter unten) jederman frei<br />
zugänglich. Besäße z.B. die Gesamtheit der Bewohner einer Gemeinde die Verfügungsrechte<br />
über den Luftraum, "könnten sie entweder diese Verfügungsrechte behalten und damit die<br />
Luftqualität über den gesetzlichen Mindeststandard anheben oder Interessenten (Teile der)<br />
exklusive(n) Verfügunsgrechte verkaufen" (Wicke 1991: 212). Neben kontrolltechnische<br />
Schwierigkeiten (mobile Emissionsquellen) und moralischen Bedenken (Informationsdefizite<br />
von Konsumenten) tritt das Problem, daß erhebliche Verhandlungskosten allein dadurch<br />
115 Zur quantitativen Bewertung von Umweltproblemen vgl. Kap. 2.2 "Das Verusacherprinzip"<br />
80