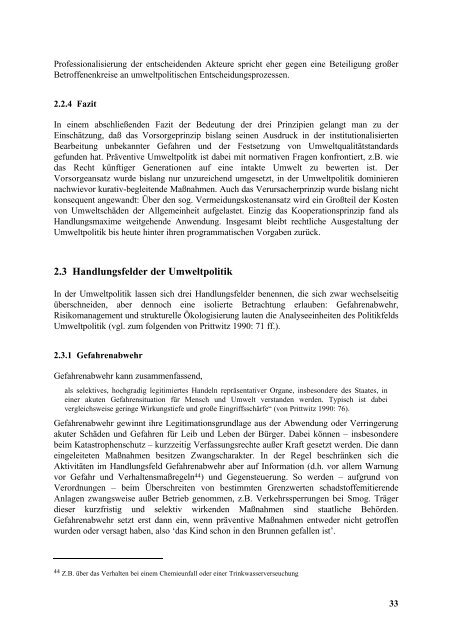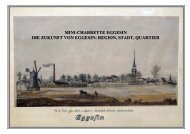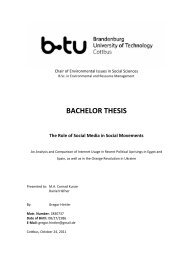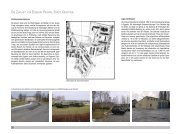Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Professionalisierung der entscheidenden Akteure spricht eher gegen eine Beteiligung großer<br />
Betroffenenkreise an umweltpolitischen Entscheidungsprozessen.<br />
2.2.4 Fazit<br />
In einem abschließenden Fazit der Bedeutung der drei Prinzipien gelangt man zu der<br />
Einschätzung, daß das Vorsorgeprinzip bislang seinen Ausdruck in der institutionalisierten<br />
Bearbeitung unbekannter Gefahren und der Festsetzung von Umweltqualitätstandards<br />
gefunden hat. Präventive Umweltpolitk ist dabei mit normativen Fragen konfrontiert, z.B. wie<br />
das Recht künftiger Generationen auf eine intakte Umwelt zu bewerten ist. Der<br />
Vorsorgeansatz wurde bislang nur unzureichend umgesetzt, in der Umweltpolitik dominieren<br />
nachwievor kurativ-begleitende Maßnahmen. Auch das Verursacherprinzip wurde bislang nicht<br />
konsequent angewandt: Über den sog. Vermeidungskostenansatz wird ein Großteil der Kosten<br />
von Umweltschäden der Allgemeinheit aufgelastet. Einzig das Kooperationsprinzip fand als<br />
Handlungsmaxime weitgehende Anwendung. Insgesamt bleibt rechtliche Ausgestaltung der<br />
Umweltpolitik bis heute hinter ihren programmatischen Vorgaben zurück.<br />
2.3 Handlungsfelder der Umweltpolitik<br />
In der Umweltpolitik lassen sich drei Handlungsfelder benennen, die sich zwar wechselseitig<br />
überschneiden, aber dennoch eine isolierte Betrachtung erlauben: Gefahrenabwehr,<br />
Risikomanagement und strukturelle Ökologisierung lauten die Analyseeinheiten des Politikfelds<br />
Umweltpolitik (vgl. zum folgenden von Prittwitz 1990: 71 ff.).<br />
2.3.1 Gefahrenabwehr<br />
Gefahrenabwehr kann zusammenfassend,<br />
als selektives, hochgradig legitimiertes Handeln repräsentativer Organe, insbesondere des Staates, in<br />
einer akuten Gefahrensituation für Mensch und Umwelt verstanden werden. Typisch ist dabei<br />
vergleichsweise geringe Wirkungstiefe und große Eingriffsschärfe“ (von Prittwitz 1990: 76).<br />
Gefahrenabwehr gewinnt ihre Legitimationsgrundlage aus der Abwendung oder Verringerung<br />
akuter Schäden und Gefahren für Leib und Leben der Bürger. Dabei können – insbesondere<br />
beim Katastrophenschutz – kurzzeitig Verfassungsrechte außer Kraft gesetzt werden. Die dann<br />
eingeleiteten Maßnahmen besitzen Zwangscharakter. In der Regel beschränken sich die<br />
Aktivitäten im Handlungsfeld Gefahrenabwehr aber auf Information (d.h. vor allem Warnung<br />
vor Gefahr und Verhaltensmaßregeln 44 ) und Gegensteuerung. So werden – aufgrund von<br />
Verordnungen – beim Überschreiten von bestimmten Grenzwerten schadstoffemitierende<br />
Anlagen zwangsweise außer Betrieb genommen, z.B. Verkehrssperrungen bei Smog. Träger<br />
dieser kurzfristig und selektiv wirkenden Maßnahmen sind staatliche Behörden.<br />
Gefahrenabwehr setzt erst dann ein, wenn präventive Maßnahmen entweder nicht getroffen<br />
wurden oder versagt haben, also ‘das Kind schon in den Brunnen gefallen ist’.<br />
44 Z.B. über das Verhalten bei einem Chemieunfall oder einer Trinkwasserverseuchung<br />
33