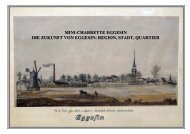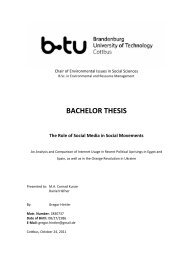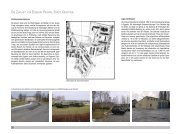Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vorgehen als eine Strategie zu kennzeichnen, mit deren Hilfe künftige negative externe Effekte<br />
schon heute in Entscheidungen Berüchsichtigung finden sollen.<br />
In dieser Betrachtung blieb bisher die normative Komponente vorsorgender Umweltpolitik<br />
unberücksichtigt: Denn trotz aller beschriebenen Rationalisierungsbemühungen bleiben<br />
umweltrelevante Entscheidungen genuin normative Entscheidungen (vgl. Decker 1994b: 118).<br />
Die Ergebnisse der Untersuchungen von Gefahrenpotentialen tragen zwar zur Versachlichung<br />
der Debatte bei, die Bewertung der Akzeptanz von Risiken erfolgt aber unter bezug auf<br />
normative Kriterien. Ein handlungsleitendes Prinzip, das dem Vorsorgegedanken entspricht,<br />
wäre das Ziel der Risikominimierung.<br />
Vorsorgepolitik im Umweltbereich hat auch eine qualitative Dimension. Im Gegensatz zu den<br />
noch unbekannten Gefahren geht es hier um die Verhinderung und Minimierung bereits<br />
erkannter Probleme, die durch gegenwärtiges Handeln verursacht werden. Die Annahme<br />
langfristig negativer Auswirkungen basiert in der Regel auf Grundlage der Extrapolation<br />
aktueller Entwicklungen. Das Informationsproblem bleibt in der Frage nach Zuverlässigkeit<br />
und Gültigkeit von Prognosen bestehen, steht aber nicht mehr im Mittelpunkt, da über die<br />
Eintrittswahrscheinlichkeit ein breiter wissenschaftlicher Konsens besteht. Die Endlichkeit<br />
wichtiger Ressourcen, die Klimakatastrophe und das Ozonloch sind Beispiele dafür. Eine dem<br />
Vorsorgeprinzip verpflichtete Umweltpolitik kann durch die Setzung materieller<br />
Qualitätsstandards und Minimierungsziele eine wichtige Konkretisierung erfahren, die der oft<br />
beklagten „inhaltlichen und instrumentellen Konturenlosigkeit“ im Umweltschutz (Schmidt<br />
1989: 7) entgegenwirkt 33 . Eine besondere Variante stellt das ‘Bestandsschutzprinzip’ (auch<br />
‘Prinzip der status-quo-Erhaltung’) dar mit dem Verbot, die Qualität der vorhandenen Umwelt<br />
zu verschlechtern. Die sich an dieser Stelle aufdrängende Frage, welche Instrumente eingesetzt<br />
werden (sollen), um diese Ziele zu erreichen, wird weiter unten behandelt (vgl. Kap. 4 und 5).<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden,<br />
„daß nach dem Vorsorgeprinzip der Umweltpolitik stets dann der Vorrang vor anderen<br />
(wirtschafts)politischen Erwägungen eingeräumt werden sollte, wenn eine wesentliche Beeinträchtigung<br />
der Lebensverhältnisse droht oder die langfristige Sicherung der Lebensgrundlagen der gegenwärtigen<br />
und zukünftigen Generationen gefährdet sind“ (Wicke 1982: 84 f.; Hervorhebungen im Original).<br />
In diesem Zitat kommt nochmals der normative Charakter des Präventionsgedankens zum<br />
Ausdruck. Es wird nämlich die Frage aufgeworfen, welches Maß an Umweltqualität im<br />
Interesse der Zukunft angestrebt werden soll. Und wie das „Problem der intergenerationellen<br />
Lasten– und Chancenverteilung“ (Decker 1994b: 123) einer gerechten Lösung zugeführt<br />
werden kann. Diese Schwierigkeiten können ohne einen Rückgriff auf ethisch fundierte<br />
Grundsätze nicht gemeistert werden. Festzuhalten bleibt, daß für die vor allem die qualitative<br />
Dimension des Vorsorgeprinzips Relevanz beanspruchen kann. Bei bekannten Gefahren und<br />
Risiken müssen die umweltpolitischen Akteure zu einer Bewertung gegenwärtiger Handlungen<br />
gelangen und durch die Festsetzung von Qualitätsstandandards Position beziehen.<br />
2.2.2 Das Verursacherprinzip<br />
Das Verursacherprinzip ist der zweite Grundpfeiler der Umweltpolitik. Inhaltlich wird dieses<br />
Prinzip durch eine Festlegung bestimmt: Umweltbelastungen werden als Kosten aufgefaßt, das<br />
33 Als Beispiel für die Konkretisierung des Vorsorgeprinzips kann das „Gebot zum Einsatz optimaler Technologien“<br />
(Schmidt 1989: 8) zur Emissionsreduktion in der Technischen Anleitung Luft (TA Luft) gelten.<br />
29