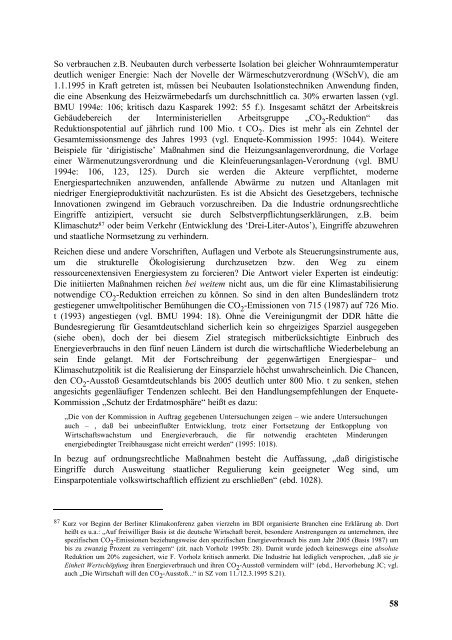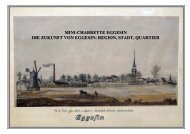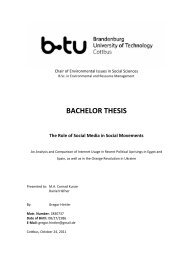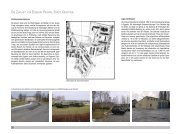Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
So verbrauchen z.B. Neubauten durch verbesserte Isolation bei gleicher Wohnraumtemperatur<br />
deutlich weniger Energie: Nach der Novelle der Wärmeschutzverordnung (WSchV), die am<br />
1.1.1995 in Kraft getreten ist, müssen bei Neubauten Isolationstechniken Anwendung finden,<br />
die eine Absenkung des Heizwärmebedarfs um durchschnittlich ca. 30% erwarten lassen (vgl.<br />
BMU 1994e: 106; kritisch dazu Kasparek 1992: 55 f.). Insgesamt schätzt der Arbeitskreis<br />
Gebäudebereich der Interministeriellen Arbeitsgruppe „CO 2 -Reduktion“ das<br />
Reduktionspotential auf jährlich rund 100 Mio. t CO 2 . Dies ist mehr als ein Zehntel der<br />
Gesamtemissionsmenge des Jahres 1993 (vgl. Enquete-Kommission 1995: 1044). Weitere<br />
Beispiele für ‘dirigistische’ Maßnahmen sind die Heizungsanlagenverordnung, die Vorlage<br />
einer Wärmenutzungsverordnung und die Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung (vgl. BMU<br />
1994e: 106, 123, 125). Durch sie werden die Akteure verpflichtet, moderne<br />
Energiespartechniken anzuwenden, anfallende Abwärme zu nutzen und Altanlagen mit<br />
niedriger Energieproduktivität nachzurüsten. Es ist die Absicht des Gesetzgebers, technische<br />
Innovationen zwingend im Gebrauch vorzuschreiben. Da die Industrie ordnungsrechtliche<br />
Eingriffe antizipiert, versucht sie durch Selbstverpflichtungserklärungen, z.B. beim<br />
Klimaschutz 87 oder beim Verkehr (Entwicklung des ‘Drei-Liter-Autos’), Eingriffe abzuwehren<br />
und staatliche Normsetzung zu verhindern.<br />
Reichen diese und andere Vorschriften, Auflagen und Verbote als Steuerungsinstrumente aus,<br />
um die strukturelle Ökologisierung durchzusetzen bzw. den Weg zu einem<br />
ressourcenextensiven Energiesystem zu forcieren? Die Antwort vieler Experten ist eindeutig:<br />
Die initiierten Maßnahmen reichen bei weitem nicht aus, um die für eine Klimastabilisierung<br />
notwendige CO 2 -Reduktion erreichen zu können. So sind in den alten Bundesländern trotz<br />
gestiegener umweltpolitischer Bemühungen die CO 2 -Emissionen von 715 (1987) auf 726 Mio.<br />
t (1993) angestiegen (vgl. BMU 1994: 18). Ohne die Vereinigungmit der DDR hätte die<br />
Bundesregierung für Gesamtdeutschland sicherlich kein so ehrgeiziges Sparziel ausgegeben<br />
(siehe oben), doch der bei diesem Ziel strategisch mitberücksichtigte Einbruch des<br />
Energieverbrauchs in den fünf neuen Ländern ist durch die wirtschaftliche Wiederbelebung an<br />
sein Ende gelangt. Mit der Fortschreibung der gegenwärtigen Energiespar– und<br />
Klimaschutzpolitik ist die Realisierung der Einsparziele höchst unwahrscheinlich. Die Chancen,<br />
den CO 2 -Ausstoß Gesamtdeutschlands bis 2005 deutlich unter 800 Mio. t zu senken, stehen<br />
angesichts gegenläufiger Tendenzen schlecht. Bei den Handlungsempfehlungen der Enquete-<br />
Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“ heißt es dazu:<br />
„Die von der Kommission in Auftrag gegebenen Untersuchungen zeigen – wie andere Untersuchungen<br />
auch – , daß bei unbeeinflußter Entwicklung, trotz einer Fortsetzung der Entkopplung von<br />
Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch, die für notwendig erachteten Minderungen<br />
energiebedingter Treibhausgase nicht erreicht werden“ (1995: 1018).<br />
In bezug auf ordnungsrechtliche Maßnahmen besteht die Auffassung, „daß dirigistische<br />
Eingriffe durch Ausweitung staatlicher Regulierung kein geeigneter Weg sind, um<br />
Einsparpotentiale volkswirtschaftlich effizient zu erschließen“ (ebd. 1028).<br />
87 Kurz vor Beginn der Berliner Klimakonferenz gaben vierzehn im BDI organisierte Branchen eine Erklärung ab. Dort<br />
heißt es u.a.: „Auf freiwilliger Basis ist die deutsche Wirtschaft bereit, besondere Anstrengungen zu unternehmen, ihre<br />
spezifischen CO 2 -Emissionen beziehungsweise den spezifischen Energieverbrauch bis zum Jahr 2005 (Basis 1987) um<br />
bis zu zwanzig Prozent zu verringern“ (zit. nach Vorholz 1995b: 28). Damit wurde jedoch keineswegs eine absolute<br />
Reduktion um 20% zugesichert, wie F. Vorholz kritisch anmerkt. Die Industrie hat lediglich versprochen, „daß sie je<br />
Einheit Wertschöpfung ihren Energieverbrauch und ihren CO 2 -Ausstoß vermindern will“ (ebd., Hervorhebung JC; vgl.<br />
auch „Die Wirtschaft will den CO 2 -Ausstoß...“ in SZ vom 11./12.3.1995 S.21).<br />
58