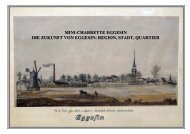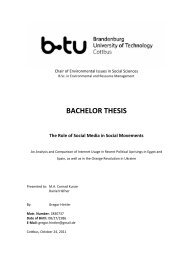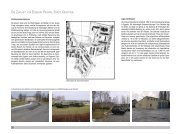Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Notlösung, da die Restemissionen bzw. die von staatlicher Seite nicht monetarisierbaren<br />
Kosten (Artensterben) der Allgemeinheit angelastet werden 40 . Und dies kann als eklatanter<br />
Verstoß gegen das Verursacherprinzip gewertet werden. W. Benkert geht soweit, daß für die<br />
Bundesrepublik Deutschland eine deutliche Dominanz des Gemeinlastprinzips festzustellen sei,<br />
d.h. daß die Kosten von Umweltschäden der Allgemeinheit aufgebürdet werden (vgl. 1986:<br />
225 ff.). Die Umweltpolitik ist von einer konsequenten Umsetzung des Verursacherprinzips<br />
noch weit entfernt. Unbestritten gibt es Ausnahmen, in denen das Gemeinlastprinzip 41 eine<br />
sinnvolle Kostenanlastungsstrategie darstellt. Und zwar wenn,<br />
„– der Verursacher nicht mehr haftbar gemacht werden kann, weil er gar nicht mehr oder in anderer<br />
Rechtsform besteht [Altlasten],<br />
– der Verursacher nicht herangezogen werden kann, weil er außerhalb des rechtlichen<br />
Zuständigkeitsbereichs angesiedelt ist [Schadstoffimport] oder<br />
– die finanziellen Mittel des Verursachers zur Schadensbeseitigung nicht ausreichen“ (Bunde 1990: 63).<br />
Brisant ist dabei der letzte Punkt, da hier die sozialpolitischen Verteilungskonflikte<br />
angesprochen werden, die auftreten, wenn die Masse der Kleinstemittenten die Kosten für ihr<br />
umweltschädigendes Verhalten auferlegt bekommt 42 .<br />
Durch den Vermeidungskostenansatz kommt es zu einer „juristisch-technischen Interpretation<br />
des Verursacherprinzips“ (Hansmeyer/Schneider 1992: 11). Für die politischen Akteure bleibt<br />
aber das Problem, daß sie Umweltschäden benennen und den dafür Verantwortlichen die<br />
Kosten für die Vermeidung aufbürden müssen: Abwehrreaktionen sind die Folge. Die<br />
Betroffenen wehren sich gegen Zusatzkosten und verlangen den Nachweis dafür, daß sie die<br />
Schuld für die inkriminierten Umweltschäden tragen. R. Schmidt bemerkt zu Recht, daß „die<br />
Zuordnung konkreter Umweltschäden zu einzelnen Schädigungsfaktoren häufig nicht<br />
vorgenommen werden [kann], wie die Diskussion um die Ursachen des Waldsterbens<br />
eindrucksvoll belegt“ (1989: 9). Auch die jahrelange Debatte über die Bedeutung von CO2 -<br />
Emissionen für die Entwicklung des Weltklimas sind ein Beleg für diese These. Der<br />
praktischen Realisierung des Verursacherprinzips stehen also eine „Reihe sehr erheblicher<br />
Probleme“ (Wicke 1982: 77) entgegen. Hierin dürfte auch der Grund für die bisherige<br />
mangelhafte Umsetzung liegen.<br />
Aber: In bezug auf den Einsatz ökonomischer Instrumente in der Umweltpolitik besitzt das<br />
Verursacherprinzips grundlegende Bedeutung (vgl. Wicke 1982: 76 f.). Dabei sollen über den<br />
Marktmechanismus die Kosten des ‘Umweltverbrauchs’ so zugerechnet werden, daß sie in die<br />
Entscheidungskalküle der Verursacher miteingehen. Unter Anspielung auf sein Konzept „Die<br />
Preise müssen die Wahrheit sagen“ schreibt von E.U. Weizsäcker:<br />
„Das Verursacherprinzip ist das marktwirtschaftlichste von den drei Grundpfeilern der Umweltpolitik<br />
und sollte als dasjenige Prinzip begriffen werden, aufgrund dessen den Preisen noch am ehesten<br />
ökologische Wahrheit aufgeprägt werden kann“ (1994: 152).<br />
40 So werden die Kosten der Umweltschäden, die durch den Kfz-Verkehrs verursacht werden, nicht allein von der Gruppe<br />
der Autofahrer getragen, sondern in einem hohen Maß auf die Allgemeinheit übergewälzt.<br />
41 Wicke widmet in seinem Standardwerk zur Umweltökonomie dem Gemeinlastprinzip ein eigenes Kapitel, um auf die<br />
Bedeutung dieses Prinzips in der umweltpolitischen Praxis hinzuweisen. Er kritisiert dies mit scharfen Worten, weil<br />
„Maßnahmen nach dem Gemeinlastprinzip keine Kopplung zum Markt“ (1982: 81, Hervorhebung im Original) haben.<br />
42 Vgl. dazu Kap. 5.6 „Sozial bzw. verteilungspolitische Probleme von Energiesteuern“<br />
31