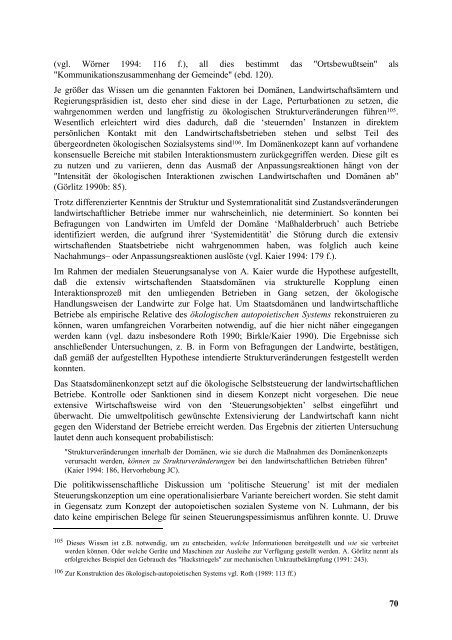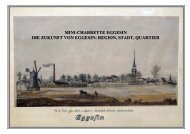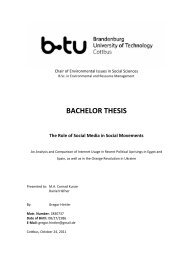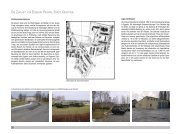Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
(vgl. Wörner 1994: 116 f.), all dies bestimmt das "Ortsbewußtsein" als<br />
"Kommunikationszusammenhang der Gemeinde" (ebd. 120).<br />
Je größer das Wissen um die genannten Faktoren bei Domänen, Landwirtschaftsämtern und<br />
Regierungspräsidien ist, desto eher sind diese in der Lage, Perturbationen zu setzen, die<br />
wahrgenommen werden und langfristig zu ökologischen Strukturveränderungen führen 105 .<br />
Wesentlich erleichtert wird dies dadurch, daß die ‘steuernden’ Instanzen in direktem<br />
persönlichen Kontakt mit den Landwirtschaftsbetrieben stehen und selbst Teil des<br />
übergeordneten ökologischen Sozialsystems sind 106 . Im Domänenkozept kann auf vorhandene<br />
konsensuelle Bereiche mit stabilen Interaktionsmustern zurückgegriffen werden. Diese gilt es<br />
zu nutzen und zu variieren, denn das Ausmaß der Anpassungsreaktionen hängt von der<br />
"Intensität der ökologischen Interaktionen zwischen Landwirtschaften und Domänen ab"<br />
(Görlitz 1990b: 85).<br />
Trotz differenzierter Kenntnis der Struktur und Systemrationalität sind Zustandsveränderungen<br />
landwirtschaftlicher Betriebe immer nur wahrscheinlich, nie determiniert. So konnten bei<br />
Befragungen von Landwirten im Umfeld der Domäne ‘Maßhalderbruch’ auch Betriebe<br />
identifiziert werden, die aufgrund ihrer ‘Systemidentität’ die Störung durch die extensiv<br />
wirtschaftenden Staatsbetriebe nicht wahrgenommen haben, was folglich auch keine<br />
Nachahmungs– oder Anpassungsreaktionen auslöste (vgl. Kaier 1994: 179 f.).<br />
Im Rahmen der medialen Steuerungsanalyse von A. Kaier wurde die Hypothese aufgestellt,<br />
daß die extensiv wirtschaftenden Staatsdomänen via strukturelle Kopplung einen<br />
Interaktionsprozeß mit den umliegenden Betrieben in Gang setzen, der ökologische<br />
Handlungsweisen der Landwirte zur Folge hat. Um Staatsdomänen und landwirtschaftliche<br />
Betriebe als empirische Relative des ökologischen autopoietischen Systems rekonstruieren zu<br />
können, waren umfangreichen Vorarbeiten notwendig, auf die hier nicht näher eingegangen<br />
werden kann (vgl. dazu insbesondere Roth 1990; Birkle/Kaier 1990). Die Ergebnisse sich<br />
anschließender Untersuchungen, z. B. in Form von Befragungen der Landwirte, bestätigen,<br />
daß gemäß der aufgestellten Hypothese intendierte Strukturveränderungen festgestellt werden<br />
konnten.<br />
Das Staatsdomänenkonzept setzt auf die ökologische Selbststeuerung der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe. Kontrolle oder Sanktionen sind in diesem Konzept nicht vorgesehen. Die neue<br />
extensive Wirtschaftsweise wird von den ‘Steuerungsobjekten’ selbst eingeführt und<br />
überwacht. Die umweltpolitisch gewünschte Extensivierung der Landwirtschaft kann nicht<br />
gegen den Widerstand der Betriebe erreicht werden. Das Ergebnis der zitierten Untersuchung<br />
lautet denn auch konsequent probabilistisch:<br />
"Strukturveränderungen innerhalb der Domänen, wie sie durch die Maßnahmen des Domänenkonzepts<br />
verursacht werden, können zu Strukturveränderungen bei den landwirtschaftlichen Betrieben führen"<br />
(Kaier 1994: 186, Hervorhebung JC).<br />
Die politikwissenschaftliche Diskussion um ‘politische Steuerung’ ist mit der medialen<br />
Steuerungskonzeption um eine operationalisierbare Variante bereichert worden. Sie steht damit<br />
in Gegensatz zum Konzept der autopoietischen sozialen Systeme von N. Luhmann, der bis<br />
dato keine empirischen Belege für seinen Steuerungspessimismus anführen konnte. U. Druwe<br />
105 Dieses Wissen ist z.B. notwendig, um zu entscheiden, welche Informationen bereitgestellt und wie sie verbreitet<br />
werden können. Oder welche Geräte und Maschinen zur Ausleihe zur Verfügung gestellt werden. A. Görlitz nennt als<br />
erfolgreiches Beispiel den Gebrauch des "Hackstriegels" zur mechanischen Unkrautbekämpfung (1991: 243).<br />
106 Zur Konstruktion des ökologisch-autopoietischen Systems vgl. Roth (1989: 113 ff.)<br />
70