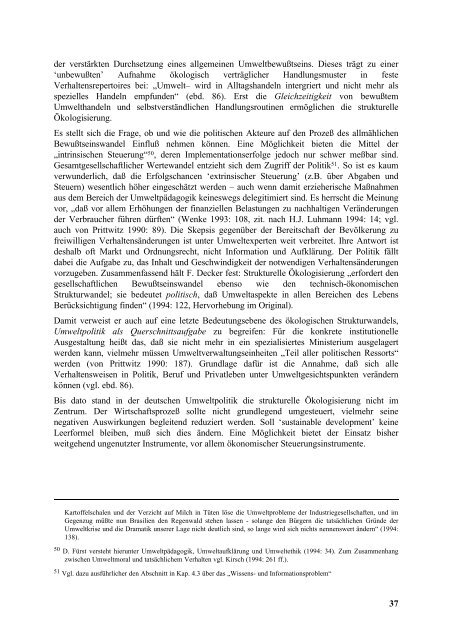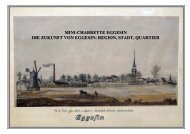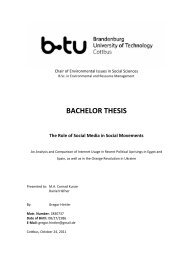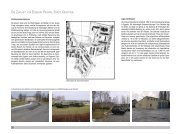Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der verstärkten Durchsetzung eines allgemeinen Umweltbewußtseins. Dieses trägt zu einer<br />
‘unbewußten’ Aufnahme ökologisch verträglicher Handlungsmuster in feste<br />
Verhaltensrepertoires bei: „Umwelt– wird in Alltagshandeln intergriert und nicht mehr als<br />
spezielles Handeln empfunden“ (ebd. 86). Erst die Gleichzeitigkeit von bewußtem<br />
Umwelthandeln und selbstverständlichen Handlungsroutinen ermöglichen die strukturelle<br />
Ökologisierung.<br />
Es stellt sich die Frage, ob und wie die politischen Akteure auf den Prozeß des allmählichen<br />
Bewußtseinswandel Einfluß nehmen können. Eine Möglichkeit bieten die Mittel der<br />
„intrinsischen Steuerung“ 50 , deren Implementationserfolge jedoch nur schwer meßbar sind.<br />
Gesamtgesellschaftlicher Wertewandel entzieht sich dem Zugriff der Politik 51 . So ist es kaum<br />
verwunderlich, daß die Erfolgschancen ‘extrinsischer Steuerung’ (z.B. über Abgaben und<br />
Steuern) wesentlich höher eingeschätzt werden – auch wenn damit erzieherische Maßnahmen<br />
aus dem Bereich der Umweltpädagogik keineswegs delegitimiert sind. Es herrscht die Meinung<br />
vor, „daß vor allem Erhöhungen der finanziellen Belastungen zu nachhaltigen Veränderungen<br />
der Verbraucher führen dürften“ (Wenke 1993: 108, zit. nach H.J. Luhmann 1994: 14; vgl.<br />
auch von Prittwitz 1990: 89). Die Skepsis gegenüber der Bereitschaft der Bevölkerung zu<br />
freiwilligen Verhaltensänderungen ist unter Umweltexperten weit verbreitet. Ihre Antwort ist<br />
deshalb oft Markt und Ordnungsrecht, nicht Information und Aufklärung. Der Politik fällt<br />
dabei die Aufgabe zu, das Inhalt und Geschwindigkeit der notwendigen Verhaltensänderungen<br />
vorzugeben. Zusammenfassend hält F. Decker fest: Strukturelle Ökologisierung „erfordert den<br />
gesellschaftlichen Bewußtseinswandel ebenso wie den technisch-ökonomischen<br />
Strukturwandel; sie bedeutet politisch, daß Umweltaspekte in allen Bereichen des Lebens<br />
Berücksichtigung finden“ (1994: 122, Hervorhebung im Original).<br />
Damit verweist er auch auf eine letzte Bedeutungsebene des ökologischen Strukturwandels,<br />
Umweltpolitik als Querschnittsaufgabe zu begreifen: Für die konkrete institutionelle<br />
Ausgestaltung heißt das, daß sie nicht mehr in ein spezialisiertes Ministerium ausgelagert<br />
werden kann, vielmehr müssen Umweltverwaltungseinheiten „Teil aller politischen Ressorts“<br />
werden (von Prittwitz 1990: 187). Grundlage dafür ist die Annahme, daß sich alle<br />
Verhaltensweisen in Politik, Beruf und Privatleben unter Umweltgesichtspunkten verändern<br />
können (vgl. ebd. 86).<br />
Bis dato stand in der deutschen Umweltpolitik die strukturelle Ökologisierung nicht im<br />
Zentrum. Der Wirtschaftsprozeß sollte nicht grundlegend umgesteuert, vielmehr seine<br />
negativen Auswirkungen begleitend reduziert werden. Soll ‘sustainable development’ keine<br />
Leerformel bleiben, muß sich dies ändern. Eine Möglichkeit bietet der Einsatz bisher<br />
weitgehend ungenutzter Instrumente, vor allem ökonomischer Steuerungsinstrumente.<br />
Kartoffelschalen und der Verzicht auf Milch in Tüten löse die Umweltprobleme der Industriegesellschaften, und im<br />
Gegenzug müßte nun Brasilien den Regenwald stehen lassen - solange den Bürgern die tatsächlichen Gründe der<br />
Umweltkrise und die Dramatik unserer Lage nicht deutlich sind, so lange wird sich nichts nennenswert ändern“ (1994:<br />
138).<br />
50 D. Fürst versteht hierunter Umweltpädagogik, Umweltaufklärung und Umweltethik (1994: 34). Zum Zusammenhang<br />
zwischen Umweltmoral und tatsächlichem Verhalten vgl. Kirsch (1994: 261 ff.).<br />
51 Vgl. dazu ausführlicher den Abschnitt in Kap. 4.3 über das „Wissens- und Informationsproblem“<br />
37