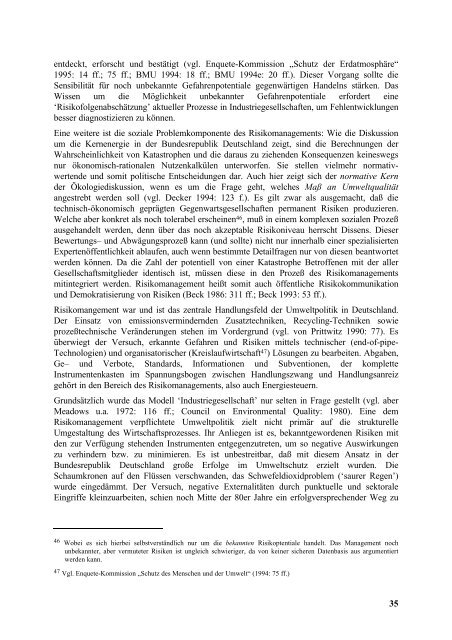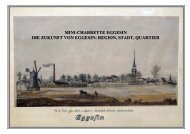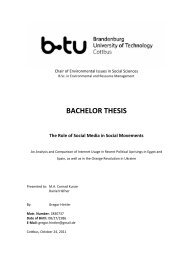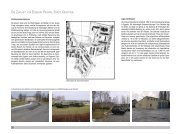Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
entdeckt, erforscht und bestätigt (vgl. Enquete-Kommission „Schutz der Erdatmosphäre“<br />
1995: 14 ff.; 75 ff.; BMU 1994: 18 ff.; BMU 1994e: 20 ff.). Dieser Vorgang sollte die<br />
Sensibilität für noch unbekannte Gefahrenpotentiale gegenwärtigen Handelns stärken. Das<br />
Wissen um die Möglichkeit unbekannter Gefahrenpotentiale erfordert eine<br />
‘Risikofolgenabschätzung’ aktueller Prozesse in Industriegesellschaften, um Fehlentwicklungen<br />
besser diagnostizieren zu können.<br />
Eine weitere ist die soziale Problemkomponente des Risikomanagements: Wie die Diskussion<br />
um die Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland zeigt, sind die Berechnungen der<br />
Wahrscheinlichkeit von Katastrophen und die daraus zu ziehenden Konsequenzen keineswegs<br />
nur ökonomisch-rationalen Nutzenkalkülen unterworfen. Sie stellen vielmehr normativwertende<br />
und somit politische Entscheidungen dar. Auch hier zeigt sich der normative Kern<br />
der Ökologiediskussion, wenn es um die Frage geht, welches Maß an Umweltqualität<br />
angestrebt werden soll (vgl. Decker 1994: 123 f.). Es gilt zwar als ausgemacht, daß die<br />
technisch-ökonomisch geprägten Gegenwartsgesellschaften permanent Risiken produzieren.<br />
Welche aber konkret als noch tolerabel erscheinen 46 , muß in einem komplexen sozialen Prozeß<br />
ausgehandelt werden, denn über das noch akzeptable Risikoniveau herrscht Dissens. Dieser<br />
Bewertungs– und Abwägungsprozeß kann (und sollte) nicht nur innerhalb einer spezialisierten<br />
Expertenöffentlichkeit ablaufen, auch wenn bestimmte Detailfragen nur von diesen beantwortet<br />
werden können. Da die Zahl der potentiell von einer Katastrophe Betroffenen mit der aller<br />
Gesellschaftsmitglieder identisch ist, müssen diese in den Prozeß des Risikomanagements<br />
mitintegriert werden. Risikomanagement heißt somit auch öffentliche Risikokommunikation<br />
und Demokratisierung von Risiken (Beck 1986: 311 ff.; Beck 1993: 53 ff.).<br />
Risikomangement war und ist das zentrale Handlungsfeld der Umweltpolitik in Deutschland.<br />
Der Einsatz von emissionsvermindernden Zusatztechniken, Recycling-Techniken sowie<br />
prozeßtechnische Veränderungen stehen im Vordergrund (vgl. von Prittwitz 1990: 77). Es<br />
überwiegt der Versuch, erkannte Gefahren und Risiken mittels technischer (end-of-pipe-<br />
Technologien) und organisatorischer (Kreislaufwirtschaft 47 ) Lösungen zu bearbeiten. Abgaben,<br />
Ge– und Verbote, Standards, Informationen und Subventionen, der komplette<br />
Instrumentenkasten im Spannungsbogen zwischen Handlungszwang und Handlungsanreiz<br />
gehört in den Bereich des Risikomanagements, also auch Energiesteuern.<br />
Grundsätzlich wurde das Modell ‘Industriegesellschaft’ nur selten in Frage gestellt (vgl. aber<br />
Meadows u.a. 1972: 116 ff.; Council on Environmental Quality: 1980). Eine dem<br />
Risikomanagement verpflichtete Umweltpolitik zielt nicht primär auf die strukturelle<br />
Umgestaltung des Wirtschaftsprozesses. Ihr Anliegen ist es, bekanntgewordenen Risiken mit<br />
den zur Verfügung stehenden Instrumenten entgegenzutreten, um so negative Auswirkungen<br />
zu verhindern bzw. zu minimieren. Es ist unbestreitbar, daß mit diesem Ansatz in der<br />
Bundesrepublik Deutschland große Erfolge im Umweltschutz erzielt wurden. Die<br />
Schaumkronen auf den Flüssen verschwanden, das Schwefeldioxidproblem (‘saurer Regen’)<br />
wurde eingedämmt. Der Versuch, negative Externalitäten durch punktuelle und sektorale<br />
Eingriffe kleinzuarbeiten, schien noch Mitte der 80er Jahre ein erfolgversprechender Weg zu<br />
46 Wobei es sich hierbei selbstverständlich nur um die bekannten Risikoptentiale handelt. Das Management noch<br />
unbekannter, aber vermuteter Risiken ist ungleich schwieriger, da von keiner sicheren Datenbasis aus argumentiert<br />
werden kann.<br />
47 Vgl. Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ (1994: 75 ff.)<br />
35