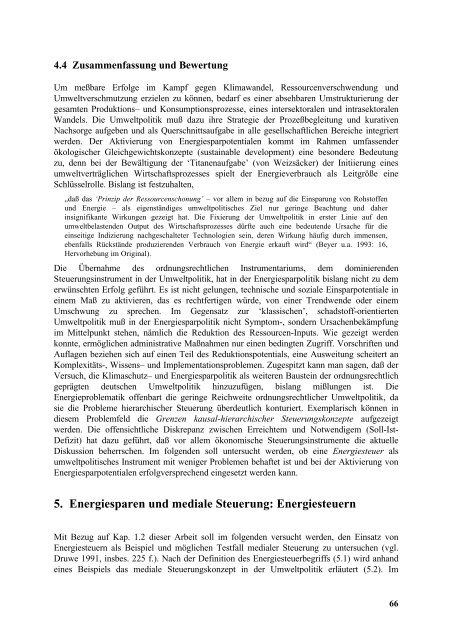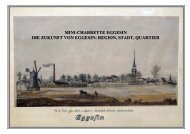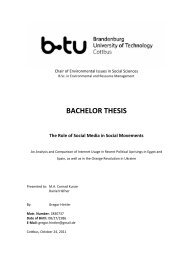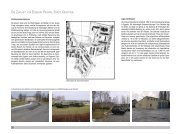Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4.4 Zusammenfassung und Bewertung<br />
Um meßbare Erfolge im Kampf gegen Klimawandel, Ressourcenverschwendung und<br />
Umweltverschmutzung erzielen zu können, bedarf es einer absehbaren Umstrukturierung der<br />
gesamten Produktions– und Konsumptionsprozesse, eines intersektoralen und intrasektoralen<br />
Wandels. Die Umweltpolitik muß dazu ihre Strategie der Prozeßbegleitung und kurativen<br />
Nachsorge aufgeben und als Querschnittsaufgabe in alle gesellschaftlichen Bereiche integriert<br />
werden. Der Aktivierung von Energiesparpotentialen kommt im Rahmen umfassender<br />
ökologischer Gleichgewichtskonzepte (sustainable development) eine besondere Bedeutung<br />
zu, denn bei der Bewältigung der ‘Titanenaufgabe’ (von Weizsäcker) der Initiierung eines<br />
umweltverträglichen Wirtschaftsprozesses spielt der Energieverbrauch als Leitgröße eine<br />
Schlüsselrolle. Bislang ist festzuhalten,<br />
„daß das ‘Prinzip der Ressourcenschonung’ – vor allem in bezug auf die Einsparung von Rohstoffen<br />
und Energie – als eigenständiges umweltpolitisches Ziel nur geringe Beachtung und daher<br />
insignifikante Wirkungen gezeigt hat. Die Fixierung der Umweltpolitik in erster Linie auf den<br />
umweltbelastenden Output des Wirtschaftsprozesses dürfte auch eine bedeutende Ursache für die<br />
einseitige Indizierung nachgeschalteter Technologien sein, deren Wirkung häufig durch immensen,<br />
ebenfalls Rückstände produzierenden Verbrauch von Energie erkauft wird“ (Beyer u.a. 1993: 16,<br />
Hervorhebung im Original).<br />
Die Übernahme des ordnungsrechtlichen Instrumentariums, dem dominierenden<br />
Steuerungsinstrument in der Umweltpolitik, hat in der Energiesparpolitik bislang nicht zu dem<br />
erwünschten Erfolg geführt. Es ist nicht gelungen, technische und soziale Einsparpotentiale in<br />
einem Maß zu aktivieren, das es rechtfertigen würde, von einer Trendwende oder einem<br />
Umschwung zu sprechen. Im Gegensatz zur ‘klassischen’, schadstoff-orientierten<br />
Umweltpolitik muß in der Energiesparpolitik nicht Symptom-, sondern Ursachenbekämpfung<br />
im Mittelpunkt stehen, nämlich die Reduktion des Ressourcen-Inputs. Wie gezeigt werden<br />
konnte, ermöglichen administrative Maßnahmen nur einen bedingten Zugriff. Vorschriften und<br />
Auflagen beziehen sich auf einen Teil des Reduktionspotentials, eine Ausweitung scheitert an<br />
Komplexitäts-, Wissens– und Implementationsproblemen. Zugespitzt kann man sagen, daß der<br />
Versuch, die Klimaschutz– und Energiesparpolitik als weiteren Baustein der ordnungsrechtlich<br />
geprägten deutschen Umweltpolitik hinzuzufügen, bislang mißlungen ist. Die<br />
Energieproblematik offenbart die geringe Reichweite ordnungsrechtlicher Umweltpolitik, da<br />
sie die Probleme hierarchischer Steuerung überdeutlich konturiert. Exemplarisch können in<br />
diesem Problemfeld die Grenzen kausal-hierarchischer Steuerungskonzepte aufgezeigt<br />
werden. Die offensichtliche Diskrepanz zwischen Erreichtem und Notwendigem (Soll-Ist-<br />
Defizit) hat dazu geführt, daß vor allem ökonomische Steuerungsinstrumente die aktuelle<br />
Diskussion beherrschen. Im folgenden soll untersucht werden, ob eine Energiesteuer als<br />
umweltpolitisches Instrument mit weniger Problemen behaftet ist und bei der Aktivierung von<br />
Energiesparpotentialen erfolgversprechend eingesetzt werden kann.<br />
5. Energiesparen und mediale Steuerung: Energiesteuern<br />
Mit Bezug auf Kap. 1.2 dieser Arbeit soll im folgenden versucht werden, den Einsatz von<br />
Energiesteuern als Beispiel und möglichen Testfall medialer Steuerung zu untersuchen (vgl.<br />
Druwe 1991, insbes. 225 f.). Nach der Definition des Energiesteuerbegriffs (5.1) wird anhand<br />
eines Beispiels das mediale Steuerungskonzept in der Umweltpolitik erläutert (5.2). Im<br />
66