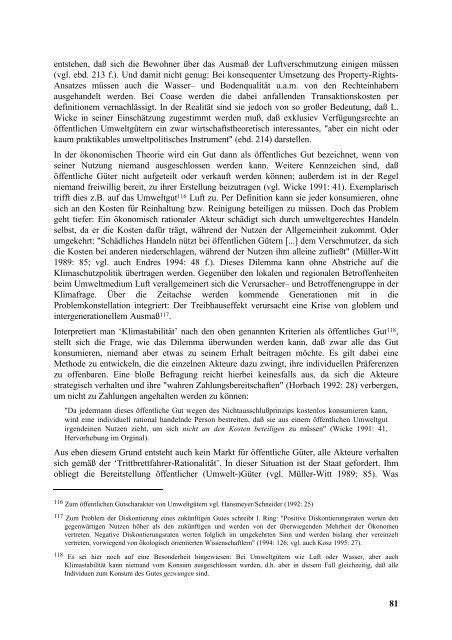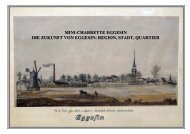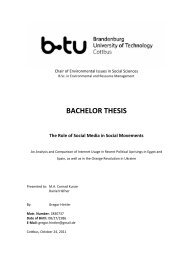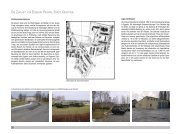Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
entstehen, daß sich die Bewohner über das Ausmaß der Luftverschmutzung einigen müssen<br />
(vgl. ebd. 213 f.). Und damit nicht genug: Bei konsequenter Umsetzung des Property-Rights-<br />
Ansatzes müssen auch die Wasser– und Bodenqualität u.a.m. von den Rechteinhabern<br />
ausgehandelt werden. Bei Coase werden die dabei anfallenden Transaktionskosten per<br />
definitionem vernachlässigt. In der Realität sind sie jedoch von so großer Bedeutung, daß L.<br />
Wicke in seiner Einschätzung zugestimmt werden muß, daß exklusiev Verfügungsrechte an<br />
öffentlichen Umweltgütern ein zwar wirtschaftstheoretisch interessantes, "aber ein nicht oder<br />
kaum praktikables umweltpolitisches Instrument" (ebd. 214) darstellen.<br />
In der ökonomischen Theorie wird ein Gut dann als öffentliches Gut bezeichnet, wenn von<br />
seiner Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Weitere Kennzeichen sind, daß<br />
öffentliche Güter nicht aufgeteilt oder verkauft werden können; außerdem ist in der Regel<br />
niemand freiwillig bereit, zu ihrer Erstellung beizutragen (vgl. Wicke 1991: 41). Exemplarisch<br />
trifft dies z.B. auf das Umweltgut 116 Luft zu. Per Definition kann sie jeder konsumieren, ohne<br />
sich an den Kosten für Reinhaltung bzw. Reinigung beteiligen zu müssen. Doch das Problem<br />
geht tiefer: Ein ökonomisch rationaler Akteur schädigt sich durch umweltgerechtes Handeln<br />
selbst, da er die Kosten dafür trägt, während der Nutzen der Allgemeinheit zukommt. Oder<br />
umgekehrt: "Schädliches Handeln nützt bei öffentlichen Gütern [...] dem Verschmutzer, da sich<br />
die Kosten bei anderen niederschlagen, während der Nutzen ihm alleine zufließt" (Müller-Witt<br />
1989: 85; vgl. auch Endres 1994: 48 f.). Dieses Dilemma kann ohne Abstriche auf die<br />
Klimaschutzpolitik übertragen werden. Gegenüber den lokalen und regionalen Betroffenheiten<br />
beim Umweltmedium Luft verallgemeinert sich die Verursacher– und Betroffenengruppe in der<br />
Klimafrage. Über die Zeitachse werden kommende Generationen mit in die<br />
Problemkonstellation integriert: Der Treibhauseffekt verursacht eine Krise von globlem und<br />
intergenerationellem Ausmaß 117 .<br />
Interpretiert man ‘Klimastabilität’ nach den oben genannten Kriterien als öffentliches Gut 118 ,<br />
stellt sich die Frage, wie das Dilemma überwunden werden kann, daß zwar alle das Gut<br />
konsumieren, niemand aber etwas zu seinem Erhalt beitragen möchte. Es gilt dabei eine<br />
Methode zu entwickeln, die die einzelnen Akteure dazu zwingt, ihre individuellen Präferenzen<br />
zu offenbaren. Eine bloße Befragung reicht hierbei keinesfalls aus, da sich die Akteure<br />
strategisch verhalten und ihre "wahren Zahlungsbereitschaften" (Horbach 1992: 28) verbergen,<br />
um nicht zu Zahlungen angehalten werden zu können:<br />
"Da jedermann dieses öffentliche Gut wegen des Nichtausschlußprinzips kostenlos konsumieren kann,<br />
wird eine individuell rational handelnde Person bestreiten, daß sie aus einem öffentlichen Umweltgut<br />
irgendeinen Nutzen zieht, um sich nicht an den Kosten beteiligen zu müssen" (Wicke 1991: 41,<br />
Hervorhebung im Orginal).<br />
Aus eben diesem Grund entsteht auch kein Markt für öffentliche Güter, alle Akteure verhalten<br />
sich gemäß der ‘Trittbrettfahrer-Rationalität’. In dieser Situation ist der Staat gefordert. Ihm<br />
obliegt die Bereitstellung öffentlicher (Umwelt-)Güter (vgl. Müller-Witt 1989: 85). Was<br />
116 Zum öffentlichen Gutscharakter von Umweltgütern vgl. Hansmeyer/Schneider (1992: 25)<br />
117 Zum Problem der Diskontierung eines zukünftigen Gutes schreibt I. Ring: "Positive Diskontierungsraten werten den<br />
gegenwärtigen Nutzen höher als den zukünftigen und werden von der überwiegenden Mehrheit der Ökonomen<br />
vertreten. Negative Diskontierungsraten werten folglich im umgekehrten Sinn und werden bislang eher vereinzelt<br />
vertreten, vorwiegend von ökologisch orientierten Wissenschaftlern" (1994: 126; vgl. auch Kosz 1995: 27).<br />
118 Es sei hier noch auf eine Besonderheit hingewiesen: Bei Umweltgütern wie Luft oder Wasser, aber auch<br />
Klimastabilität kann niemand vom Konsum ausgeschlossen werden, d.h. aber in diesem Fall gleichzeitig, daß alle<br />
Individuen zum Konsum des Gutes gezwungen sind.<br />
81