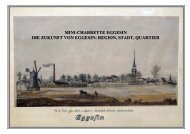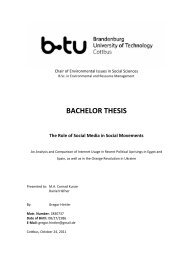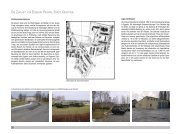Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der Bundesrepublik sind europaweit die meisten Rauchgasentschwefelungs– und Entstickungsanlagen in<br />
Betrieb“ (Wilhelm 1994: 80) 88 .<br />
Die mit Abstand wichtigsten Emissionsquellen von SO 2 waren Kraft– und Fernheizwerke (vgl.<br />
BMWi 1994: 42). Bei diesen stationären Anlagen standen den umweltpolitischen Akteuren<br />
eindeutig identifizierbare Verursacher gegenüber, die über einen hohen Organisationsgrad<br />
verfügen 89 . Es gelang, die interne Struktur der Umweltverwaltungen „korrespondierend zu der<br />
ausdifferenzierten und hochkomplexen Umwelt“ (Druwe 1994: 66), in diesem Fall der<br />
Energieversorgungsunternehmen, aufzubauen: Ein entscheidender Schritt bei der Bearbeitung<br />
des Varietätsproblems. Die Voraussetzungen dafür, daß Steuerungsvorgaben ignoriert oder<br />
umgangen werden konnten, wurden weitestgehend ausgeschaltet, z.B. weil spezialisiertes<br />
Fachwissen bei den Umweltbehörden institutionalisiert werden konnte 90 . Gegen den teilweise<br />
erheblichen Widerstand der Akteure wurde der Einbau von Rauchgasentschwefelungsanlagen<br />
durchgesetzt, obwohl eine „handlungsfähige Organisation sektorspezifischer Interessen“<br />
durchaus in der Lage sein kann, „Veto-Macht auszuüben und gesellschaftliche<br />
Problemlösungen zu blockieren“ (Mayntz 1987: 105). Beim Versuch, einen Anstoß zur<br />
strukturellen Ökologisierung des Energie– und Wirtschaftssystems zu geben, stellt sich die<br />
Situation anders dar. Hier lautet der Ansatz,<br />
„wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen politisch so zu beeinflussen, daß Ressourcen geschont<br />
und Schadstoffemissionen minimiert werden. Hierzu gehören beispielsweise die durchgehende<br />
Berücksichtigung und hohe politische Gewichtung von Energiespar-Gesichtspunkten<br />
(Energiesparpolitik), die Favorisierung des öffentlichen Nah– und Fernverkehrs und ‘sanftere’ Formen<br />
der Chemie mit geringem Risikopotential“ (von Prittwitz 1990: 57 f., Hervorhebung JC).<br />
In der Energiesparpolitik sind es nicht die wenigen zentralen Anlagen (wie z.B. Kraftwerke),<br />
die über die größten Einsparpotentiale 91 verfügen, sondern die Masse der Verbraucher in der<br />
Industrie, die Haushalte und der Verkehr (vgl. Enquete-Kommission 1995: 260 ff.; von<br />
Weizsäcker 1994: 74). Damit wird die gesamte Bandbreite der gesellschaftlichen Akteure<br />
umfaßt. Im Gegensatz zu den eindeutig bestimmbaren Hauptverursachern von Gesundheit und<br />
Wald schädigenden Schwefel– oder Stickstoffemissionen ist eine Politik der Verringerung des<br />
Ressourcen-Inputs mit einer unüberschaubaren Masse an Akteuren konfrontiert, die über<br />
jeweils völlig unterschiedliche und spezifische Einsparpotentiale verfügen. Mit der Reichweite<br />
des Eingriffs vergrößert sich die Variablenmenge (vgl. Görlitz 1990: 16): Industriebetriebe<br />
88 Es soll nicht unbemerkt bleiben, daß beim Einsatz von Filtertechnologien hochgiftiger Sondermüll anfällt. Nicht<br />
Emissionsvermeidung, sondern mediale Umschichtung ist die Folge nachsorgender end-of-pipe-Technologien.<br />
89 R. Mayntz weist im Zusammenhang der politischen Steuerbarkeit von „handlungsfähigen Akteuren höherer Ordnung<br />
(Organisationen, Verbänden“) darauf hin, „daß in größeren, intern differenzierten Organisationen der gesamte<br />
Interaktionsstil für rechtsförmige Regelungen besonders offen sei“. Auch die Tatsache, „daß Organisationen infolge<br />
entsprechender struktureller und prozeduraler Vorkehrungen in ihrem Handeln tendenziell rationaler und damit auch<br />
berechenbarer sind als das Ergebnis kumulierender bzw. aggregierter Individualhandlungen, erhöht die<br />
Steuerungsmöglichkeiten“ (1987: 103).<br />
90 Die ordnungsrechtlichen Grundlagen schuf die Großfeuerungsanlagen-Verordnung nach der 13. BImSchV: Sie stellt<br />
materielle Anforderungen an Kohle, Öl und gasgefeuerte Anlagen, „insbesondere zur Begrenzung von Stoffen, die zum<br />
Problem „saurer Regen“ beitragen (SO 2 , NO x , HCL, HF)“ (Wicke 1991: 181). Beyer u.a. prognostizieren unter<br />
Verweis auf eine Studie des Umweltbundesamts bis 1998 weitere „beträchtliche Verminderungen“ dieser<br />
Massenschadstoffe. Zurückzuführen sind diese Emissionssenkungen dabei unter anderem „auf die insbesondere den<br />
Energieerzeugungs- und Industriesektor betreffende Großfeuerungsanlagenverordnung und andere<br />
immissionsschutzrechtliche Regelungen (1993: 9, Hervorhebung JC).<br />
91 Im Bericht der Enquete-Kommission wird der Potentialbegriff unterschieden in Erwartungs-, wirtschaftliches,<br />
technisches und theoretisches Potential (vgl. 1995: 257). Hier sind die technischen Einsparpotentiale gemeint.<br />
60