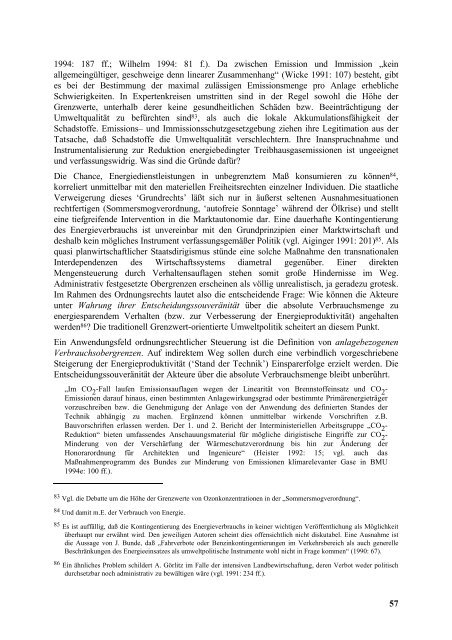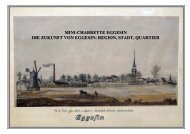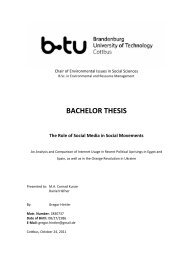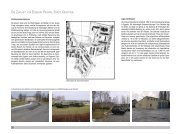Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1994: 187 ff.; Wilhelm 1994: 81 f.). Da zwischen Emission und Immission „kein<br />
allgemeingültiger, geschweige denn linearer Zusammenhang“ (Wicke 1991: 107) besteht, gibt<br />
es bei der Bestimmung der maximal zulässigen Emissionsmenge pro Anlage erhebliche<br />
Schwierigkeiten. In Expertenkreisen umstritten sind in der Regel sowohl die Höhe der<br />
Grenzwerte, unterhalb derer keine gesundheitlichen Schäden bzw. Beeinträchtigung der<br />
Umweltqualität zu befürchten sind 83 , als auch die lokale Akkumulationsfähigkeit der<br />
Schadstoffe. Emissions– und Immissionsschutzgesetzgebung ziehen ihre Legitimation aus der<br />
Tatsache, daß Schadstoffe die Umweltqualität verschlechtern. Ihre Inanspruchnahme und<br />
Instrumentalisierung zur Reduktion energiebedingter Treibhausgasemissionen ist ungeeignet<br />
und verfassungswidrig. Was sind die Gründe dafür?<br />
Die Chance, Energiedienstleistungen in unbegrenztem Maß konsumieren zu können 84 ,<br />
korreliert unmittelbar mit den materiellen Freiheitsrechten einzelner Individuen. Die staatliche<br />
Verweigerung dieses ‘Grundrechts’ läßt sich nur in äußerst seltenen Ausnahmesituationen<br />
rechtfertigen (Sommersmogverordnung, ‘autofreie Sonntage’ während der Ölkrise) und stellt<br />
eine tiefgreifende Intervention in die Marktautonomie dar. Eine dauerhafte Kontingentierung<br />
des Energieverbrauchs ist unvereinbar mit den Grundprinzipien einer Marktwirtschaft und<br />
deshalb kein mögliches Instrument verfassungsgemäßer Politik (vgl. Aiginger 1991: 201) 85 . Als<br />
quasi planwirtschaftlicher Staatsdirigismus stünde eine solche Maßnahme den transnationalen<br />
Interdependenzen des Wirtschaftssystems diametral gegenüber. Einer direkten<br />
Mengensteuerung durch Verhaltensauflagen stehen somit große Hindernisse im Weg.<br />
Administrativ festgesetzte Obergrenzen erscheinen als völlig unrealistisch, ja geradezu grotesk.<br />
Im Rahmen des Ordnungsrechts lautet also die entscheidende Frage: Wie können die Akteure<br />
unter Wahrung ihrer Entscheidungssouveränität über die absolute Verbrauchsmenge zu<br />
energiesparendem Verhalten (bzw. zur Verbesserung der Energieproduktivität) angehalten<br />
werden 86 ? Die traditionell Grenzwert-orientierte Umweltpolitik scheitert an diesem Punkt.<br />
Ein Anwendungsfeld ordnungsrechtlicher Steuerung ist die Definition von anlagebezogenen<br />
Verbrauchsobergrenzen. Auf indirektem Weg sollen durch eine verbindlich vorgeschriebene<br />
Steigerung der Energieproduktivität (‘Stand der Technik’) Einsparerfolge erzielt werden. Die<br />
Entscheidungssouveränität der Akteure über die absolute Verbrauchsmenge bleibt unberührt.<br />
„Im CO 2 -Fall laufen Emissionsauflagen wegen der Linearität von Brennstoffeinsatz und CO 2 -<br />
Emissionen darauf hinaus, einen bestimmten Anlagewirkungsgrad oder bestimmte Primärenergieträger<br />
vorzuschreiben bzw. die Genehmigung der Anlage von der Anwendung des definierten Standes der<br />
Technik abhängig zu machen. Ergänzend können unmittelbar wirkende Vorschriften z.B.<br />
Bauvorschriften erlassen werden. Der 1. und 2. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe „CO 2 -<br />
Reduktion“ bieten umfassendes Anschauungsmaterial für mögliche dirigistische Eingriffe zur CO 2 -<br />
Minderung von der Verschärfung der Wärmeschutzverordnung bis hin zur Änderung der<br />
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure“ (Heister 1992: 15; vgl. auch das<br />
Maßnahmenprogramm des Bundes zur Minderung von Emissionen klimarelevanter Gase in BMU<br />
1994e: 100 ff.).<br />
83 Vgl. die Debatte um die Höhe der Grenzwerte von Ozonkonzentrationen in der „Sommersmogverordnung“.<br />
84 Und damit m.E. der Verbrauch von Energie.<br />
85 Es ist auffällig, daß die Kontingentierung des Energieverbrauchs in keiner wichtigen Veröffentlichung als Möglichkeit<br />
überhaupt nur erwähnt wird. Den jeweiligen Autoren scheint dies offensichtlich nicht diskutabel. Eine Ausnahme ist<br />
die Aussage von J. Bunde, daß „Fahrverbote oder Benzinkontingentierungen im Verkehrsbereich als auch generelle<br />
Beschränkungen des Energieeinsatzes als umweltpolitische Instrumente wohl nicht in Frage kommen“ (1990: 67).<br />
86 Ein ähnliches Problem schildert A. Görlitz im Falle der intensiven Landbewirtschaftung, deren Verbot weder politisch<br />
durchsetzbar noch administrativ zu bewältigen wäre (vgl. 1991: 234 ff.).<br />
57