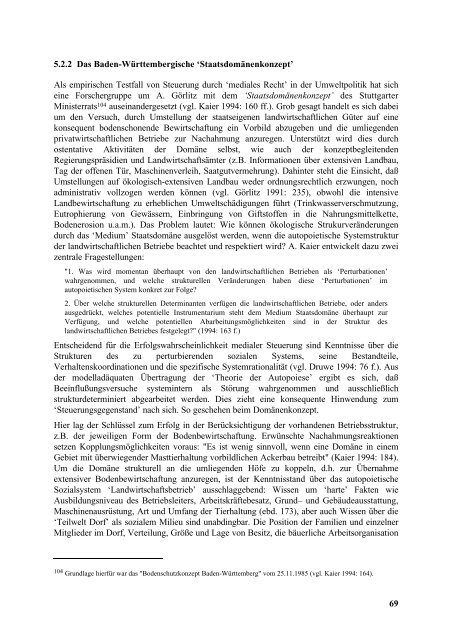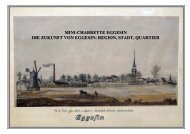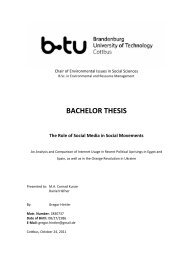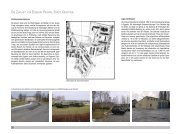Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
5.2.2 Das Baden-Württembergische ‘Staatsdomänenkonzept’<br />
Als empirischen Testfall von Steuerung durch ‘mediales Recht’ in der Umweltpolitik hat sich<br />
eine Forschergruppe um A. Görlitz mit dem ‘Staatsdomänenkonzept’ des Stuttgarter<br />
Ministerrats 104 auseinandergesetzt (vgl. Kaier 1994: 160 ff.). Grob gesagt handelt es sich dabei<br />
um den Versuch, durch Umstellung der staatseigenen landwirtschaftlichen Güter auf eine<br />
konsequent bodenschonende Bewirtschaftung ein Vorbild abzugeben und die umliegenden<br />
privatwirtschaftlichen Betriebe zur Nachahmung anzuregen. Unterstützt wird dies durch<br />
ostentative Aktivitäten der Domäne selbst, wie auch der konzeptbegleitenden<br />
Regierungspräsidien und Landwirtschaftsämter (z.B. Informationen über extensiven Landbau,<br />
Tag der offenen Tür, Maschinenverleih, Saatgutvermehrung). Dahinter steht die Einsicht, daß<br />
Umstellungen auf ökologisch-extensiven Landbau weder ordnungsrechtlich erzwungen, noch<br />
administrativ vollzogen werden können (vgl. Görlitz 1991: 235), obwohl die intensive<br />
Landbewirtschaftung zu erheblichen Umweltschädigungen führt (Trinkwasserverschmutzung,<br />
Eutrophierung von Gewässern, Einbringung von Giftstoffen in die Nahrungsmittelkette,<br />
Bodenerosion u.a.m.). Das Problem lautet: Wie können ökologische Strukurveränderungen<br />
durch das ‘Medium’ Staatsdomäne ausgelöst werden, wenn die autopoietische Systemstruktur<br />
der landwirtschaftlichen Betriebe beachtet und respektiert wird? A. Kaier entwickelt dazu zwei<br />
zentrale Fragestellungen:<br />
"1. Was wird momentan überhaupt von den landwirtschaftlichen Betrieben als ‘Perturbationen’<br />
wahrgenommen, und welche strukturellen Veränderungen haben diese ‘Perturbationen’ im<br />
autopoietischen System konkret zur Folge?<br />
2. Über welche strukturellen Determinanten verfügen die landwirtschaftlichen Betriebe, oder anders<br />
ausgedrückt, welches potentielle Instrumentarium steht dem Medium Staatsdomäne überhaupt zur<br />
Verfügung, und welche potentiellen Abarbeitungsmöglichkeiten sind in der Struktur des<br />
landwirtschaftlichen Betriebes festgelegt?" (1994: 163 f.)<br />
Entscheidend für die Erfolgswahrscheinlichkeit medialer Steuerung sind Kenntnisse über die<br />
Strukturen des zu perturbierenden sozialen Systems, seine Bestandteile,<br />
Verhaltenskoordinationen und die spezifische Systemrationalität (vgl. Druwe 1994: 76 f.). Aus<br />
der modelladäquaten Übertragung der ‘Theorie der Autopoiese’ ergibt es sich, daß<br />
Beeinflußungsversuche systemintern als Störung wahrgenommen und ausschließlich<br />
strukturdeterminiert abgearbeitet werden. Dies zieht eine konsequente Hinwendung zum<br />
‘Steuerungsgegenstand’ nach sich. So geschehen beim Domänenkonzept.<br />
Hier lag der Schlüssel zum Erfolg in der Berücksichtigung der vorhandenen Betriebsstruktur,<br />
z.B. der jeweiligen Form der Bodenbewirtschaftung. Erwünschte Nachahmungsreaktionen<br />
setzen Kopplungsmöglichkeiten voraus: "Es ist wenig sinnvoll, wenn eine Domäne in einem<br />
Gebiet mit überwiegender Masttierhaltung vorbildlichen Ackerbau betreibt" (Kaier 1994: 184).<br />
Um die Domäne strukturell an die umliegenden Höfe zu koppeln, d.h. zur Übernahme<br />
extensiver Bodenbewirtschaftung anzuregen, ist der Kenntnisstand über das autopoietische<br />
Sozialsystem ‘Landwirtschaftsbetrieb’ ausschlaggebend: Wissen um ‘harte’ Fakten wie<br />
Ausbildungsniveau des Betriebsleiters, Arbeitskräftebesatz, Grund– und Gebäudeausstattung,<br />
Maschinenausrüstung, Art und Umfang der Tierhaltung (ebd. 173), aber auch Wissen über die<br />
‘Teilwelt Dorf’ als sozialem Milieu sind unabdingbar. Die Position der Familien und einzelner<br />
Mitglieder im Dorf, Verteilung, Größe und Lage von Besitz, die bäuerliche Arbeitsorganisation<br />
104 Grundlage hierfür war das "Bodenschutzkonzept Baden-Württemberg" vom 25.11.1985 (vgl. Kaier 1994: 164).<br />
69