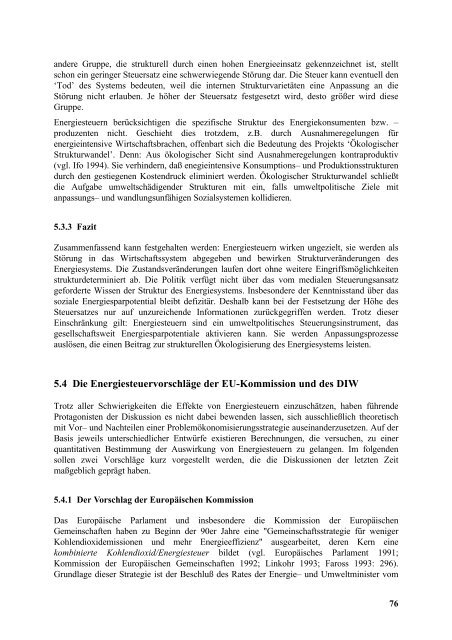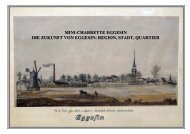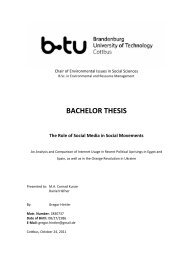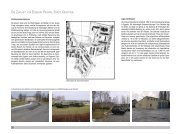Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Projekt Ökosteuer - Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Umweltfragen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
andere Gruppe, die strukturell durch einen hohen Energieeinsatz gekennzeichnet ist, stellt<br />
schon ein geringer Steuersatz eine schwerwiegende Störung dar. Die Steuer kann eventuell den<br />
‘Tod’ des Systems bedeuten, weil die internen Strukturvarietäten eine Anpassung an die<br />
Störung nicht erlauben. Je höher der Steuersatz festgesetzt wird, desto größer wird diese<br />
Gruppe.<br />
Energiesteuern berücksichtigen die spezifische Struktur des Energiekonsumenten bzw. –<br />
produzenten nicht. Geschieht dies trotzdem, z.B. durch Ausnahmeregelungen für<br />
energieintensive Wirtschaftsbrachen, offenbart sich die Bedeutung des <strong>Projekt</strong>s ‘Ökologischer<br />
Strukturwandel’. Denn: Aus ökologischer Sicht sind Ausnahmeregelungen kontraproduktiv<br />
(vgl. Ifo 1994). Sie verhindern, daß enegieintensive Konsumptions– und Produktionsstrukturen<br />
durch den gestiegenen Kostendruck eliminiert werden. Ökologischer Strukturwandel schließt<br />
die Aufgabe umweltschädigender Strukturen mit ein, falls umweltpolitische Ziele mit<br />
anpassungs– und wandlungsunfähigen Sozialsystemen kollidieren.<br />
5.3.3 Fazit<br />
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Energiesteuern wirken ungezielt, sie werden als<br />
Störung in das Wirtschaftssystem abgegeben und bewirken Strukturveränderungen des<br />
Energiesystems. Die Zustandsveränderungen laufen dort ohne weitere Eingriffsmöglichkeiten<br />
strukturdeterminiert ab. Die Politik verfügt nicht über das vom medialen Steuerungsansatz<br />
geforderte Wissen der Struktur des Energiesystems. Insbesondere der Kenntnisstand über das<br />
soziale Energiesparpotential bleibt defizitär. Deshalb kann bei der Festsetzung der Höhe des<br />
Steuersatzes nur auf unzureichende Informationen zurückgegriffen werden. Trotz dieser<br />
Einschränkung gilt: Energiesteuern sind ein umweltpolitisches Steuerungsinstrument, das<br />
gesellschaftsweit Energiesparpotentiale aktivieren kann. Sie werden Anpassungsprozesse<br />
auslösen, die einen Beitrag zur strukturellen Ökologisierung des Energiesystems leisten.<br />
5.4 Die Energiesteuervorschläge der EU-Kommission und des DIW<br />
Trotz aller Schwierigkeiten die Effekte von Energiesteuern einzuschätzen, haben führende<br />
Protagonisten der Diskussion es nicht dabei bewenden lassen, sich ausschließlich theoretisch<br />
mit Vor– und Nachteilen einer Problemökonomisierungsstrategie auseinanderzusetzen. Auf der<br />
Basis jeweils unterschiedlicher Entwürfe existieren Berechnungen, die versuchen, zu einer<br />
quantitativen Bestimmung der Auswirkung von Energiesteuern zu gelangen. Im folgenden<br />
sollen zwei Vorschläge kurz vorgestellt werden, die die Diskussionen der letzten Zeit<br />
maßgeblich geprägt haben.<br />
5.4.1 Der Vorschlag der Europäischen Kommission<br />
Das Europäische Parlament und insbesondere die Kommission der Europäischen<br />
Gemeinschaften haben zu Beginn der 90er Jahre eine "Gemeinschaftsstrategie für weniger<br />
Kohlendioxidemissionen und mehr Energieeffizienz" ausgearbeitet, deren Kern eine<br />
kombinierte Kohlendioxid/Energiesteuer bildet (vgl. Europäisches Parlament 1991;<br />
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1992; Linkohr 1993; Faross 1993: 296).<br />
Grundlage dieser Strategie ist der Beschluß des Rates der Energie– und Umweltminister vom<br />
76