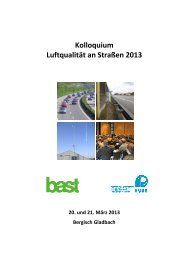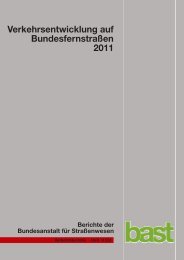Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
106<br />
sehr hohe Aufhaltefähigkeit bei gleichzeitig geringem<br />
Platzangebot eine hohe Steifigkeit der Systeme<br />
erfordert, mit der Folge einer höheren Insassenbelastung<br />
bei leichten Fahrzeugen.<br />
8.2 Einwirkung auf die Brückenkonstruktion<br />
infolge des Anpralls<br />
eines schweren Fahrzeugs<br />
Bei Prüfungen von Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe<br />
H4b für den Einsatz auf Brücken kann festgestellt<br />
werden, dass bei einem Lkw-Anprall sehr<br />
hohe Kräfte auftreten können, die durch die Bauwerke<br />
aufgenommen werden müssen. Die hier dokumentierten<br />
Anprallprüfungen an sechs verschiedenen<br />
Schutzeinrichtungen zeigen die Größenordnung<br />
der auftretenden Kräfte von H4b-Systemen.<br />
Diese Werte bestätigen die Untersuchungen in [10]<br />
und [11]. <strong>Das</strong> zeigt, dass diese Kraftwerte keine<br />
Ausnahme darstellen, sondern zukünftig vielmehr<br />
den Regelfall abbilden.<br />
Die gemessenen Kräfte erreichen ein Lastniveau,<br />
welches um bis zum Sechsfachen über dem liegt,<br />
was nach dem DIN Fachbericht „Einwirkungen“,<br />
Ausgabe 2003 [7], bei einer Tragwerksbemessung<br />
anzusetzen war; nach dem gültigen DIN-Fachbericht<br />
101 von 2009 [14] ist eine Klasseneinteilung<br />
vorgesehen, in die die geprüften Systeme eingeordnet<br />
werden können, siehe auch www.bast.de –<br />
Qualitätsbewertung – Listen – Straßenausstattung.<br />
Die Untersuchungen zeigen, dass die Beanspruchbarkeiten<br />
der Brückenkappe und der Kappenanschlussbewehrung<br />
in der Regel auf der sicheren<br />
Seite liegen. Insbesondere die Kappenanschlussbewehrung<br />
war zu Beginn der Überlegungen als<br />
besonders kritisch betrachtet worden. Die Ergebnisse<br />
der Anprallprüfungen zeigen, dass diese Einschätzung<br />
nur bei sehr wenigen Systemen zutrifft.<br />
In den meisten Fällen erfolgt durch die aktivierte<br />
Scheibenwirkung der Kappe bei der Lastabtragung<br />
eine ausreichende Verteilung der Lasten auf die<br />
Nachbarbereiche, wobei die Kappenanschlussbewehrung<br />
eine weitaus geringere Beanspruchung<br />
erfährt als zunächst erwartet worden war.<br />
Grundsätzlich kann die Scheibenwirkung nur aktiviert<br />
werden, wenn die Schutzeinrichtung relativ<br />
fahrbahnnah aufgebaut wird. Steht die Schutzeinrichtung<br />
am äußeren Kappenrand, „wandern“ die<br />
Kräfte auf direktem Weg in die Anschlussbewehrung.<br />
In diesem Fall kann ein Lastniveau erreicht<br />
werden, dass bereits bei H2-Systemen zu einer<br />
Überbeanspruchung der Kappenanschlussbewehrung<br />
führt [11]. Da aber im Regelfall der Aufbau der<br />
Systeme meist im fahrbahnnahen Bereich der<br />
Brückenkappe erfolgt, ist eine Lastausbreitung gegeben.<br />
Es ist jedoch in jedem Einzelfall zu beachten,<br />
welche Schutzeinrichtung eine Erhöhung der<br />
Kappenanschlussbewehrung erfordert.<br />
Der Einfluss der empfohlenen und gegenüber dem<br />
DIN-Fachbericht von 2003 [7] erhöhten Einwirkungen<br />
aus Fahrzeuganprall an eine Schutzeinrichtung<br />
ist unterschiedlich zu bewerten. Bei Neubauten von<br />
Brücken ist der Mehraufwand geringer einzuschätzen<br />
als bei Instandsetzungen, da durch entsprechende<br />
konstruktive Maßnahmen, wie beispielsweise<br />
Erhöhung der Bewehrungsmenge, den größeren<br />
Lasten Rechnung getragen werden kann.<br />
Anders stellt sich der Sachverhalt bei bereits bestehenden<br />
Bauwerken dar. Wie in [10] bereits erläutert,<br />
gehen Verstärkungsmaßnahmen im Regelfall<br />
mit hohem technischem und finanziellem Aufwand<br />
einher. Wird allerdings durch eine Kraftmessung für<br />
eine Schutzeinrichtung die Verträglichkeit dieser<br />
mit der Brückenkonstruktion nachgewiesen, so bestehen<br />
sowohl ein höheres Maß an Sicherheit als<br />
auch die Möglichkeit, finanzielle Ressourcen zu<br />
schonen. In diesem Fall kann durch die Installation<br />
einer verträglichen Schutzeinrichtung auf Verstärkungsmaßnahmen<br />
verzichtet werden, die gegebenenfalls<br />
bei Installation einer alternativen Schutzeinrichtung<br />
unverzichtbar wären. Wichtig ist in<br />
jedem Fall aber zu wissen, wie groß die tatsächlichen<br />
Einwirkungen sind, damit eine sichere und<br />
wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung getroffen werden<br />
kann. Ohne diese Kenntnis ist eine technisch<br />
und wirtschaftlich sinnvolle Entscheidungsfindung<br />
sehr schwierig.<br />
9 Weitergehende Überlegungen<br />
9.1 Allgemeines<br />
Ziel dieses Forschungsprojektes ist es gewesen,<br />
Schutzeinrichtungen auf Brücken mit sehr hohem<br />
Aufhaltevermögen zu prüfen und den Nachweis zu<br />
erbringen, dass diese die Anforderungen der DIN<br />
EN 1317 [4] erfüllen und somit eingesetzt werden<br />
können. Dafür wurden im Vorfeld Rahmenbedingungen<br />
(siehe Kapitel 3.1 und 3.3) formuliert, die<br />
bei der Entwicklung der Schutzeinrichtungen berücksichtigt<br />
werden sollten.