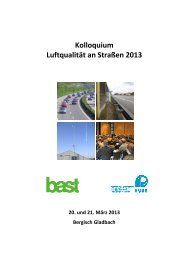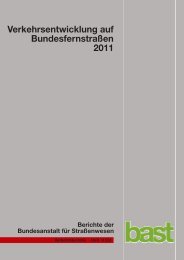Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
108<br />
vom Schrammbord lassen die RPS eine Unterschreitung<br />
des Regelabstands von 0,50 m in begründeten<br />
Fällen zu. Da das Aufhalten eines 38<br />
Tonners auf einer Brücke aufgrund der beengten<br />
Platzverhältnisse und der Vorgaben bezüglich der<br />
Krafteinleitung eine besondere Herausforderung an<br />
die Schutzeinrichtung darstellt, kann es in diesen<br />
Fällen als akzeptabel angesehen werden, dass der<br />
Abstand zum Schrammbord unterschritten wird,<br />
wodurch alle Systeme konform zur RPS 2009 [9]<br />
eingesetzt werden können.<br />
Der für den Notgehweg erforderliche Platzbedarf<br />
von 0,75 m wurde bei einigen Prüfungen unterschritten.<br />
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass<br />
diese Unterschreitung mit 0,06 bis 0,17 m im oberflächennahen<br />
Bereich der Brückenkappe stattfindet<br />
(z. B. Fußplatten ragen in den Notgehweg). Vor<br />
diesem Hintergrund und aufgrund des besonderen<br />
Einsatzfalles einer H4b-Schutzeinrichtung auf<br />
einem Brückenbauwerk zum Schutz unbeteiligter<br />
Dritter unterhalb der Brücke wird empfohlen zu prüfen,<br />
ob der erforderliche Raum für den Notgehweg<br />
im Einzelfall reduziert werden kann. Die Einhaltung<br />
der Breite des Notgehweges dient in erster Linie<br />
der Arbeitssicherheit bei Brückenprüfungen bzw.<br />
dem Betriebsdienst. Die Einhaltung des Schrammbordabstandes<br />
kann z. B. wichtig werden, wenn in<br />
diesem Bereich eine Arbeitsstelle mit einer 4+0<br />
Verkehrsführung eingerichtet wird.<br />
Grundsätzlich bleibt ein strukturelles Problem bestehen,<br />
da nach Kap 1 eigentlich nur Schutzeinrichtungen<br />
mit einem Wirkungsbereich der Klasse<br />
W3 (≤ 1,0 m) eingesetzt werden können, da für<br />
die Klasse W4 der erforderliche Raum von 1,3 m<br />
nicht zur Verfügung steht, sofern nicht der Nachweis<br />
im Versuch erbracht wurde, dass das Fahrzeug<br />
auch bei einem größeren Wirkungsbereich sicher<br />
umgelenkt und aufgehalten wird. <strong>Das</strong> Forschungsprojekt<br />
hat gezeigt, dass lediglich zwei<br />
Systeme die Wirkungsbereichsklasse W4 erreicht<br />
haben. Damit besteht derzeit die Situation, unabhängig<br />
von der konkreten Aufstellanordnung auf<br />
der Brückenkappe, dass Schutzeinrichtungen für<br />
die Brücke mit der Aufhaltestufe H4b existieren, die<br />
als minimale Wirkungsbereichsklasse W4 aufweisen.<br />
Es wird auch auf Basis der Erkenntnisse aus<br />
diesem Projekt für unwahrscheinlich gehalten, dass<br />
sich Schutzeinrichtungen mit sehr hohem Aufhaltevermögen<br />
entwickeln lassen, die mit einer sehr geringen<br />
Baubreite (≤ 0,5 m) einen Wirkungsbereich<br />
von W3 (≤ 1,0 m) erreichen und gleichzeitig die Belastung<br />
für Pkw-Insassen in einem akzeptablen<br />
Rahmen halten. Bereits jetzt haben die Hersteller<br />
der untersuchten Systeme versucht, eine minimal<br />
mögliche Breite zu konstruieren, was sich an Baubreiten<br />
zwischen 0,56 und 0,71 m zeigt.<br />
Um auch zukünftigen Entwicklungen von weiteren<br />
Schutzeinrichtungen mit sehr hohem Aufhaltevermögen<br />
auf Bauwerken eine Perspektive zu bieten<br />
und auch eine eindeutige Situation für Planung und<br />
Ausschreibung geben zu können, wurde die Breite<br />
der Brückenkappe nach Kap 1 um 0,05 m auf 2,05<br />
m vergrößert. Die Verbreiterung der Kappe hat den<br />
Vorteil, dass der Raum bis zur Geländervorderkante<br />
so breit ist, dass Systeme mit einem Abstand<br />
zum Schrammbord von 0,5 m und mit einem Wirkungsbereich<br />
W4 eingesetzt werden können. Lediglich<br />
bei einer Systembreite von mehr als 0,55 m<br />
müssen die Systeme noch hinsichtlich der einzuhaltenden<br />
Breite eines Notgehweges weitergehend<br />
betrachtet werden.<br />
9.4 Geländer<br />
Bei den Anprallprüfungen wurde das Geländer Gel<br />
3 nach [3] verwendet. Da das Geländer bei zwei<br />
Systemen in der Anprallprüfung mitgewirkt hat, ist<br />
es Bestandteil der Schutzeinrichtung und in der<br />
Praxis mit aufzubauen wie in der Prüfung. Eine Veränderung<br />
des Abstandes zwischen Geländer und<br />
Schutzeinrichtung ist bei diesen Systemen nicht zu<br />
empfehlen.<br />
Bei allen anderen Systemen können alternative Geländer<br />
verwendet werden, sofern die geometrischen<br />
Randbedingungen es zulassen und die Aufstellung<br />
außerhalb des Wirkungsbereiches erfolgt.<br />
Dies gilt grundsätzlich auch für das System, bei<br />
dem das Geländer ohne Mitwirkung im Wirkungsbereich<br />
installiert war, wobei zusätzlich zu beachten<br />
ist, dass bei Installation des Geländers innerhalb<br />
des Wirkungsbereiches der Abstand zur Schutzeinrichtung<br />
aus der Prüfung nicht unterschritten wird.<br />
9.5 Änderung der Verankerung<br />
Die Versuche haben gezeigt, dass die Verankerung<br />
einen maßgeblichen Einfluss auf das Verhalten der<br />
Schutzeinrichtung im Anprallfall hat. Die Verankerung<br />
der Systeme auf der Brückenkappe stellt somit<br />
einen wesentlichen Systembestandteil dar und Veränderungen<br />
daran sind sehr genau und einzelfallspezifisch<br />
zu prüfen. Dies gilt insbesondere hin