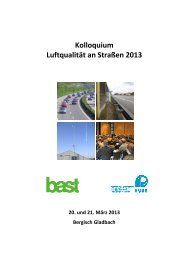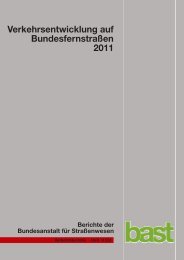Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
110<br />
auszulegen, damit sich bei einer Beschädigung<br />
derselben nach Möglichkeit Teile nicht beziehungsweise<br />
nicht vollständig lösen können. Eine Möglichkeit<br />
wäre es, kombinierte Systeme aus Schutzeinrichtung<br />
und Lärmschutzwand beziehungsweise<br />
Übersteigschutz zu entwickeln und zu prüfen. Dies<br />
hat jedoch den Nachteil, dass es sich um singuläre<br />
Lösungen handelt, die die Vielfalt an Gestaltungselementen<br />
bei Lärmschutzwänden nicht abdecken<br />
können. Besser wäre es noch, Schutzeinrichtungen<br />
zu entwickeln, bei denen der Fahrzeugüberhang<br />
begrenzt wird.<br />
9.7 Übersteigbarkeit der<br />
Schutzeinrichtung<br />
Im Allgemeinen sollte es möglich sein, dass Schutzeinrichtungen<br />
für den Notfall übersteigbar sind. Eine<br />
allgemeingültige Regelung diesbezüglich gibt es bislang<br />
nicht. Bei den Anprallprüfungen wurde festgestellt,<br />
dass die montierten Schutzeinrichtungen<br />
Höhen von 1,07 bis 1,68 m aufweisen. Diese Höhen<br />
liegen deutlich über den Höhen der meisten bisherigen<br />
Systeme nach RPS 1989 [1]. Die Übersteigbarkeit<br />
der H4b-Schutzeinrichtungen wurde im Rahmen<br />
der Anprallprüfungen lediglich empirisch untersucht.<br />
Als Ergebnis ist festzustellen, dass bei allen Systemen<br />
ein gewisses Maß an körperlicher Beweglichkeit<br />
erforderlich ist. Bewegungseingeschränkte und<br />
kleinere Personen dürften generell Schwierigkeiten<br />
haben, die Systeme zu überwinden.<br />
<strong>Das</strong> Übersteigen von hohen Schutzeinrichtungen<br />
zeigt noch einen weiteren Aspekt auf, der darin<br />
liegt, dass beim Überwinden der Systemhöhe (zwischen<br />
1,07 und 1,68 m) der Blick auf der Systemrückseite<br />
talwärts gerichtet ist, was für die betreffende<br />
Person bei ungehinderter Sicht durch das<br />
persönliche Empfinden von einer unangenehmen<br />
bis hin zu einer gefährlichen Situation werden kann.<br />
Auch ein situationsbedingtes rasches Übersteigen<br />
kann dazu führen, dass der doch relativ schmale<br />
Raum eines Notgehweges verfehlt wird, es zu Verletzungen<br />
durch Hängenbleiben oder im schlimmsten<br />
Fall zu einem Absturz von der Brücke kommen<br />
kann. Denkbar sind hierfür Lösungen durch Erhöhen<br />
des Geländers oder das Anbringen eines Sichtschutzes,<br />
wobei die Ausführungen der vorhergehenden<br />
Abschnitte beachtet werden sollten. Besser<br />
ist es jedoch, alternative Lösungen in Betracht zu<br />
ziehen. Vor dem Hintergrund, dass der Aufenthalt<br />
von Personen im Bereich von Brückenbauwerken,<br />
wenn nicht planmäßig vorgesehen, nur in Notfällen<br />
erfolgt, könnte auch darüber nachgedacht werden,<br />
ob nicht eine den Tunneln vergleichbare Situation<br />
vorliegt. Dort ist eine Kennzeichnung des Fluchtweges<br />
vorgesehen, bei der auch der kürzere Weg zu<br />
einer sicheren Stelle angezeigt wird. Denkbar wäre<br />
eine vergleichbare Kennzeichnung an der Schutzeinrichtung,<br />
die jedoch deren Funktionsweise nicht<br />
beeinträchtigen darf.<br />
9.8 Abweichung von der Ausführung<br />
der Brückenkappe entsprechend<br />
Kap 1<br />
Bei einer veränderten Ausführung der Brückenkappe<br />
ist im Einzelfall zu prüfen, ob die in diesem Forschungsprojekt<br />
geprüften Systeme verwendet werden<br />
können. Ausgehend von den vielfältigen Ausgestaltungen<br />
der Brückenkappen bei den bestehenden<br />
Brückenbauwerken kommen zahlreiche<br />
Varianten in Betracht, so zum Beispiel unterschiedliche<br />
Breiten und Neigungen der Brückenkappen,<br />
variierende Höhen der Schrammborde und die Verwendung<br />
von Stahl anstelle von Beton. Die Vielfältigkeit<br />
der Abweichungen lässt nur die Überprüfung<br />
des Einzelfalles zu. Diese Einzelfallprüfung<br />
sollte immer im Hinblick auf das zu erreichende<br />
Schutzziel erfolgen. Dies gilt insbesondere, wenn<br />
die zu verwendende Brückenkappe in mehreren<br />
Punkten von der bei der Prüfung verwendeten<br />
Brückenkappe nach Richtzeichnung Kap 1 abweicht.<br />
Der Verankerung der Schutzeinrichtung kommt<br />
auch an dieser Stelle besondere Bedeutung zu, da<br />
die Verankerung der Schutzeinrichtung mittels<br />
eines Ankers im Verbund mit Beton anders wirkt als<br />
die Schraubverbindung oder eine Schweißverbindung<br />
bei einer Brückenkappe aus Stahl. So kann<br />
zum Beispiel der Beton unter der Lasteinwirkung<br />
abplatzen oder die Stahlunterlage sich verformen.<br />
Dies kann sich dann zum Beispiel bei einer Schutzeinrichtung<br />
auf die Schiefstellung der Pfosten und<br />
damit auf das Verhalten der Schutzeinrichtung im<br />
Anprallfall auswirken. Wenn also Modifikationen bewertet<br />
werden sollen, sind die Verhaltensmechanismen<br />
der betreffenden Schutzeinrichtung zwingend<br />
zu beachten.<br />
Es sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass<br />
die Abweichung(en) zur Brückenkappe nach Kap 1<br />
und die daran angepassten Veränderungen der<br />
Schutzeinrichtung nicht zu einer Minderung der<br />
Schutzwirkung führen dürfen.