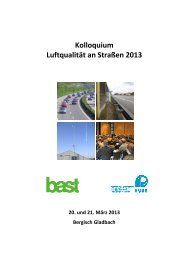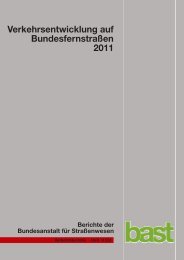Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
13<br />
einem Bestand von ca. 37.000 Brücken im Zuge<br />
von Bundesfernstraßen, stellt daher Forderungen<br />
auf, die Schutzeinrichtungen erfüllen müssen. Im<br />
Rahmen eines von der <strong>BASt</strong> erstellten „Pflichtenhefts<br />
für die Konstruktion von Fahrzeugrückhaltesystemen<br />
der Aufhaltestufe H4b auf Brücken“, welches<br />
in Kapitel 3.4 dokumentiert ist, erfolgt die<br />
Festlegung, welchen Anforderungen Fahrzeugrückhaltesysteme<br />
mit sehr hoher Durchbruchsicherheit<br />
für den Einsatz auf Brücken genügen<br />
müssen.<br />
Nach den Ergänzungen zu den RPS [2] gilt, dass<br />
neu entwickelte Fahrzeugrückhaltesysteme mittels<br />
erfolgreicher Anprallprüfungen ihre Eignung nachweisen<br />
müssen. Die Anprallprüfungen werden<br />
nach den Vorgaben der DIN EN 1317 [4] durchgeführt<br />
und ausgewertet. Zusätzlich werden im<br />
Pflichtenheft (Kapitel 3.4) weitere Anforderungen<br />
formuliert. Diese Anforderungen richten sich in erster<br />
Linie an Schutzeinrichtungen, die auf vorhandenen<br />
Brücken eingesetzt werden sollen. Schutzeinrichtungen,<br />
die diese Anforderungen erfüllen,<br />
können dann gleichermaßen bei Neubauten eingesetzt<br />
werden. Die in dem Pflichtenheft enthaltenen<br />
Anforderungen sind so ausgelegt, dass möglichst<br />
keine Veränderungen der Brücken- bzw. der<br />
Brückenkappenkonstruktion nötig sind, um<br />
Schutzeinrichtungen mit sehr hoher Rückhaltefähigkeit<br />
auf Brücken installieren zu können. Im<br />
Pflichtenheft wird der Grundsatz verfolgt, dass<br />
Schutzeinrichtungen so konstruiert sein müssen,<br />
dass deren Einsatz ohne zusätzliche Ertüchtigungsmaßnahmen<br />
bestehender Brücken möglich<br />
ist. Gleichzeitig soll die Rückhaltefähigkeit gegenüber<br />
den bisher eingesetzten Standard-Schutzeinrichtungen<br />
erhöht werden, möglichst ohne eine erhöhte<br />
Gefährdung für Pkw-Insassen in Kauf nehmen<br />
zu müssen.<br />
3.1 Anforderungen an eine<br />
Prüfeinrichtung aus Sicht des<br />
Brückenbaus<br />
3.1.1 Allgemeines<br />
Deutschland weist neben Österreich als einziges<br />
Land die Besonderheit auf, dass Schutzeinrichtungen<br />
und Geländer bei Betonbrücken nicht auf dem<br />
Konstruktionsbeton der Fahrbahnplatte, sondern<br />
auf einer Brückenkappe (in Österreich: Randleiste)<br />
befestigt werden. Die Kappe wird durch die Brückenabdichtung<br />
vom Konstruktionsbeton getrennt<br />
und ist nur stirnseitig durch die Kappenanschlussbewehrung<br />
mit dem Überbau durch Bewehrungsstäbe<br />
2 Ø 12 mm im Abstand von 40 cm verbunden.<br />
Lediglich bei reinen Stahlbrücken sind die Kappen<br />
ebenfalls aus Stahl gefertigt. Dies betrifft aber nur<br />
7 % der Brücken im Zuge von Bundesfernstraßen.<br />
Die restlichen 93 % der Brücken werden in Beton,<br />
Stahlbeton oder Verbundbauweise mit Betonkappen<br />
ausgeführt.<br />
Damit bei einer Anprallprüfung möglichst realistische<br />
Bedingungen herrschen, ist es erforderlich,<br />
eine Kappe nachzubauen, auf der die Schutzeinrichtungen<br />
installiert werden können. Für die Konstruktion<br />
der Kappe sollen dabei die Vorgaben der<br />
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen<br />
und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING) [8]<br />
(Betontechnologie) und der RiZ-ING [3] (konstruktive<br />
Ausführung) eingehalten werden. Der Regelfall<br />
der Kappenausbildung in Deutschland ist in der<br />
Richtzeichnung Kap 1 (Bild 2) dargestellt. Die Brückenkappe<br />
ist 2 m breit und weist eine Querneigung<br />
von 4 % auf. Nach Kap 1 wird die 50 cm breite<br />
Schutzeinrichtung 50 cm von der Schrammbordkante<br />
zurückversetzt installiert. Am Gesimsrand<br />
wird ein Geländer entsprechend den Richtzeichnungen<br />
Gel montiert. Zwischen Geländer und Hinterkante<br />
der Schutzeinrichtung ist ein 75 cm breiter<br />
Betriebs- bzw. Fluchtweg vorgesehen.<br />
Diese Vorgaben gelten auch für die neu zu entwickelnden<br />
Schutzeinrichtungen. Besonderer Wert ist<br />
dabei auf den Betriebsweg zu legen, damit auch bei<br />
der Installation neu entwickelter Schutzeinrichtungen<br />
weiterhin eine Bauwerksprüfung nach DIN<br />
1076 [9] bzw. Richtlinie zur einheitlichen Erfassung,<br />
Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen<br />
der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076<br />
(RI-EBW-PRÜF) [10] möglich ist.<br />
Aus den Voruntersuchungen der <strong>BASt</strong> [6] ist ferner<br />
bekannt, dass die beim Anprallvorgang resultierenden<br />
Einwirkungen eine relevante Größenordnung<br />
aufweisen. Damit sichergestellt werden kann, dass<br />
die Beanspruchbarkeiten der Bauwerke beim Anprallvorgang<br />
nicht überschritten werden, liegt ein<br />
besonderes Interesse in der Ermittlung der Größe<br />
der auftretenden Beanspruchungen. Eine zuverlässige<br />
Aussage über die auftretenden Kräfte ist aber<br />
nur dann möglich, wenn diese beim Anprallvorgang<br />
gemessen werden. <strong>Das</strong> bedeutet, dass eine Prüfeinrichtung<br />
benötigt wird, mit der eine Kraftmessung<br />
während des Anprallversuchs durchgeführt<br />
werden kann.