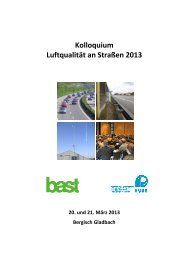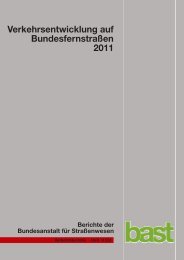Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Dokument 1.pdf - ELBA: Das elektronische BASt-Archiv - hbz
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
45<br />
Diese Messungen beruhen auf einem Einzelereignis,<br />
zeigen aber dennoch die Größenordnung der<br />
beim Anprallvorgang entstehenden Einwirkungen.<br />
Aus den Messwerten wurde ein Vorschlag erarbeitet,<br />
für welche Einwirkungen Brücken bemessen<br />
werden sollen, auf denen die in Kapitel 5 diskutierte<br />
Schutzeinrichtung installiert werden soll. Die<br />
genauen Werte der ermittelten Einwirkungsgrößen<br />
gelten nur für die untersuchte Schutzeinrichtung.<br />
Die Größenordnung der Werte lässt sich jedoch<br />
auf andere Schutzeinrichtungen mit sehr hohem<br />
Aufhaltevermögen auf Brücken übertragen. Der<br />
Vorschlag sieht Einwirkungen vor, die etwa 3- bis<br />
4-mal höher liegen, als der derzeitige Lastansatz<br />
des DIN-Fachberichts 101 „Einwirkungen“ [15].<br />
Damit wurden wichtige Eckwerte für die zukünftige<br />
Bemessung neuer Brücken bzw. für das Nachrüsten<br />
bestehender Brücken gewonnen. Vor allem<br />
diese Erkenntnis sollte in die Regelwerke aufgenommen<br />
werden. Die Nachbildung der Brückenkappe<br />
wies nach dem in Kapitel 5 geschilderten<br />
Versuch keine Schäden auf.<br />
Für Brückenneubauten ist es erforderlich, die<br />
Größe der zugehörigen Kräfte einer Schutzeinrichtung<br />
zu kennen, damit eine Bemessung wirtschaftlich<br />
sinnvoll, aber dennoch sicher erfolgen<br />
kann. Darüber hinaus ist diese Kenntnis insbesondere<br />
bei der Brückeninstandsetzung erforderlich,<br />
weil nur dann entschieden werden kann, welche<br />
Schutzeinrichtung für das Brückenbauwerk verträglich<br />
ist und welche Verstärkungsmaßnahmen<br />
erforderlich sind.<br />
Daher sollte bei der Regelwerksfortschreibung die<br />
Forderung mit aufgenommen werden, dass zukünftig<br />
für alle Schutzeinrichtungen ein Nachweis<br />
über die Größe der beim Anprallvorgang in das<br />
Bauwerk eingeleiteten Kräfte erforderlich ist. Dieser<br />
Nachweis sollte durch eine Messung der Kräfte<br />
in einer realen Anprallprüfung erbracht werden.<br />
Vor Durchführung des Projektes bestand Unklarheit<br />
darüber, ob der durch den äußeren Rand der<br />
Brückenkappe beschränkte seitliche Deformationsraum<br />
ausreicht, um mit Schutzeinrichtungen<br />
auch sehr schwere von der Fahrbahn abkommende<br />
Lkw kontrolliert aufhalten zu können. Um den<br />
vorhandenen seitlichen Raum optimal zu nutzen,<br />
wurde zugelassen, die Schutzeinrichtung in größtmöglicher<br />
Entfernung vom Rand der Brückenkappe<br />
zu installieren und den Mindestabstand zur<br />
Fahrbahn von 50 cm auf der Brücke zu unterschreiten.<br />
Im Laufe des Projektes zeigte sich jedoch,<br />
dass diese Unterschreitung des Mindestabstands<br />
zwar Vorteile mit sich bringt, aber im Bedarfsfall<br />
einer 4+0-Verkehrsführung Schwierigkeiten<br />
bereitet.<br />
Die derzeit bestehenden Richtlinien (RiZ-ING,<br />
RPS) fordern einerseits einen Mindestabstand der<br />
Schutzeinrichtungen zur Fahrbahn von 50 cm und<br />
andererseits einen Mindestabstand zwischen<br />
Schutzeinrichtung und Geländer von 75 cm. Vor<br />
dem Hintergrund der Geometrie nach RiZ Kap 1<br />
lassen sich beide Anforderungen nur dann erfüllen,<br />
wenn die Schutzeinrichtung selbst nicht breiter als<br />
50 cm ist. Die bisherige Erfahrung aus dem vorliegenden<br />
Projekt zeigt aber, dass Schutzeinrichtungen<br />
der Aufhaltestufe H4b für den Einsatz auf Brücken<br />
im Regelfall eine größere Baubreite aufweisen.<br />
Während die Einhaltung des einen Maßes der<br />
Verkehrssicherheit dient, dient die Einhaltung des<br />
anderen Maßes der Arbeitssicherheit bei Brückenprüfungen.<br />
Auf Basis der in diesem Projekt gewonnenen<br />
Erfahrungen ist zu klären, welche von beiden<br />
Anforderungen eher eingeschränkt werden<br />
kann, um die Anordnung von Schutzeinrichtungen<br />
der Aufhaltestufe H4b festlegen zu können.<br />
Die hier qualitativ diskutierte Betonschutzwand aus<br />
Fertigteilen ist nicht geeignet, das Problem sehr<br />
hoher Aufhaltefähigkeit auf Brücken allein zu lösen.<br />
Die Nachrüstung bestehender Brückenbauwerke<br />
mit geringeren Tragfähigkeiten erfordert den Einsatz<br />
leichterer Schutzeinrichtungen. Es ist daher<br />
erforderlich, das begonnene Versuchsprogramm<br />
fortzuführen, bis auch Stahlschutzeinrichtungen<br />
die Anforderungen erfüllen. Darüber hinaus ist es<br />
für eine wirtschaftliche und gleichzeitig sichere Bemessung<br />
von Brücken grundsätzlich notwendig,<br />
die auftretenden Kräfte zu kennen, sodass alle<br />
Schutzeinrichtungen auf Brücken hinsichtlich ihrer<br />
zugehörigen Einwirkungsgrößen im Rahmen einer<br />
Anprallprüfung untersucht werden sollten. Inzwischen<br />
wurden weitere Schutzeinrichtungen positiv<br />
geprüft. Es ist geplant, die Ergebnisse dieser Prüfungen<br />
und Beschreibungen der Systeme in einem<br />
späteren Bericht zu veröffentlichen.<br />
8 Literatur<br />
[1] Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen:<br />
Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen<br />
an Straßen – Ausgabe 1989 (RPS<br />
89), FGSV Verlag GmbH, Köln, 1989