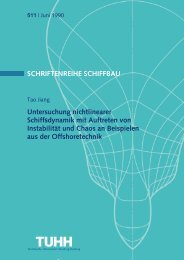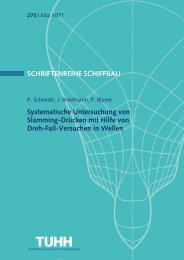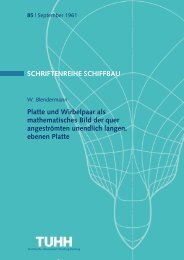dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.4 Optimale Anordnung der Einzelstrahler<br />
d<br />
d<br />
a) d<br />
b) d<br />
Abbildung 2.14: Zirkular polarisierte Gruppenstrahler nach dem Prinzip der sequenziellen Rotation<br />
auf a) einem quadratischen und b) einem dreieckigem Gitter.<br />
θ max von Elementabstand und Schwenkwinkel.<br />
|θ max<br />
| [°]<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
φ=0/90°<br />
φ=±45°<br />
0<br />
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0<br />
d x<br />
=d y<br />
=d [λ 0<br />
]<br />
Abbildung 2.15: Maximaler Schwenkwinkel<br />
θ max für Gruppenstrahler auf rechteckigen Gittern<br />
und sequenzieller Rotation der Elemente<br />
um 90 ◦ als Funktion des Elementabstandes (berechnet<br />
mit Gleichung 2.30).<br />
Man erkennt sehr gut, wie groß der Unterschied von θ max für die unterschiedlichen Richtungen<br />
φ = 0/90 ◦ und φ = ±45 ◦ ausfällt. Der Nachteil der sequenziellen Rotation ist demnach eine Erhöhung<br />
der Dichte der Elemente (und Chipsätze im Falle aktiver Antennen) um 100 %. Man erhält<br />
folglich die gleiche Dichte wie für die Konfiguration in Abbildung 2.12a und zwei Chipsätzen pro<br />
Antennenelement zur Realisierung von PDM.<br />
Soll nun beim dreieckigen Gitter aus Abbildung 2.14b der maximale Schwenkbereich in Abhängigkeit<br />
von der Hauptstrahlrichtung ermittelt werden, ist das Ergebnis nur schwierig zu interpretieren.<br />
Zwar können die elektrischen Feldvektoren in ihre orthogonalen Komponenten zerlegt werden, wie<br />
in Abbildung 2.16 zu sehen ist, allerdings weisen nicht sämtliche Komponenten die gleiche Amplitude<br />
auf.<br />
Jedes Element hat einen vertikalen Anteil, wobei eins von drei Elementen die Amplitude 1 hat,<br />
die verbleibenden zwei haben eine Amplitude von 0,5. Bei den horizontalen Anteilen ergibt sich<br />
die gleiche Periodizität, allerdings wechseln die Amplituden zwischen 0 und √ 3/2. Wegen dieser<br />
unterschiedlichen Amplituden lässt sich der Mindestabstand zwischen zwei identisch polarisierten<br />
Strahlern zur Unterdrückung von sekundären Hauptkeulen nicht direkt bestimmen.<br />
25