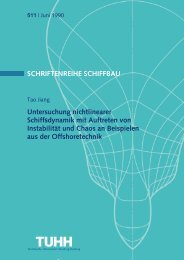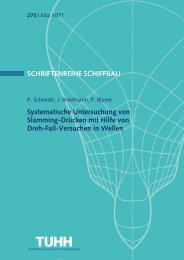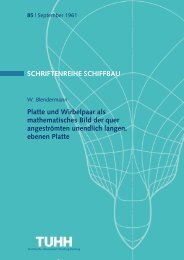dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
dissertation_kuhlmann_2013.pdf (5.032 KB)
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
2.4 Optimale Anordnung der Einzelstrahler<br />
mit<br />
m = 0, ±1, ±2, ... , m = 0 ⇒ n !<br />
≠ 0, (2.59)<br />
n = 0, ±1, ±2, ... , n = 0 ⇒ m !<br />
≠ 0, (2.60)<br />
p = 0, ±1, ±2, ... , (2.61)<br />
q = 0, ±1, ±2, ... . (2.62)<br />
Die resultierenden Richtungen für die sekundären Hauptkeulen sind somit<br />
u n,d = nλ 0<br />
+ u 0 , (2.63)<br />
d x<br />
v m,d = λ 0(m − n)<br />
2<br />
+ v 0 , (2.64)<br />
d y<br />
u p,d = λ ( )<br />
0 1<br />
d x 3 + p + u 0 und (2.65)<br />
v q,d = λ (<br />
0<br />
− 1 d y 2 − p )<br />
2 + q + v 0 . (2.66)<br />
Die Gleichungen 2.63 und 2.64 für die kopolaren sekundären Hauptkeulen können - wie auch beim<br />
rechteckigen Gitter - in [23, 26] oder ähnlichen Werken über Grundlagen von Gruppenstrahlern gefunden<br />
werden.<br />
Ergebnisse<br />
Wie bereits angedeutet, können Einzelstrahler mit einer starken Direktivität die Amplitude von sekundären<br />
Hauptkeulen für große Schwenkwinkel stark absenken. Es könnte also ein zweites Kriterium<br />
für sekundäre Hauptkeulen definiert werden, derart, dass diese erst ab einer Amplitude in<br />
der Größenordnung der Nebenkeulen in Betracht gezogen werden. Allerdings wäre diese Herangehensweise<br />
sehr stark anwendungsabhängig, weshalb im Folgenden nach wie vor von isotropen<br />
Kugelstrahlern ausgegangen wird.<br />
Abbildung 2.17 zeigt die Richtungen der ko- und kreuzpolaren sekundären Hauptkeulen eines planaren<br />
Gruppenstrahlers auf einem rechteckigen Gitter mit einem Elementabstand von d x = d y =<br />
0, 5 λ 0 , errechnet mit den Gleichungen (2.31), (2.32), (2.46) und (2.47) im uv-Raum. Man erkennt,<br />
dass die sekundären Hauptkeulen ebenfalls auf einem rechteckigen Gitter liegen. Es ist das inverse<br />
Gitter des Gruppenstrahlers, die Abstände sind λ 0 /d x und λ 0 /d y [23].<br />
Wenn die Hauptkeule exemplarisch in Richtung φ 0 = 30 ◦ und θ 0 = 60 ◦ geschwenkt wird, befinden<br />
sich keine kopolaren sekundären Hauptkeulen im sichtbaren Bereich, jedoch eine kreuzpolare, wie<br />
in Abbildung 2.18 zu sehen ist. Abhängig vom Elementabstand und der Hauptstrahlrichtung können<br />
mehrere oder keine sekundären Hauptkeulen im sichtbaren Bereich entstehen.<br />
Der Schwenkbereich dieses Gruppenstrahlers kann direkt mit einfachen trigonometrischen Mitteln<br />
berechnet werden (Flächenberechnung). Dazu wird die Hauptkeule auf φ 0 = 0 ◦ und θ 0 = 0 ◦ ausgerichtet.<br />
Der Schwenkbereich entspricht der Fläche des sichtbaren Bereichs abzüglich der von vier<br />
Kreisen mit dem gleichen Durchmesser wie der sichtbare Bereich und mit den Mittelpunkten auf<br />
den am nächsten gelegenen vier sekundären Hauptkeulen, wie in Abbildung 2.19 zu sehen ist.<br />
29