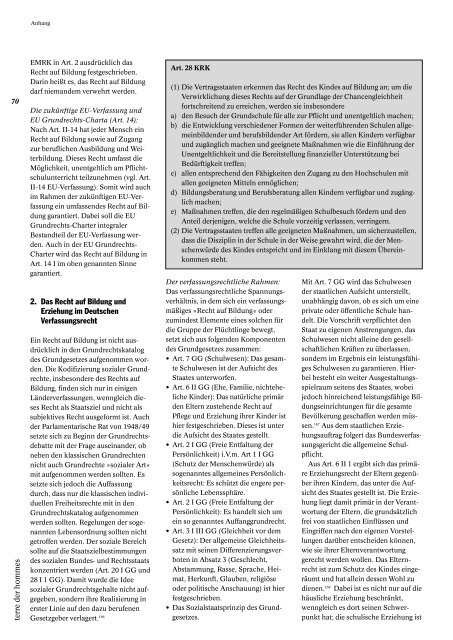Wir bleiben draußen!
Wir bleiben draußen!
Wir bleiben draußen!
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Anhang<br />
70<br />
terre der hommes<br />
EMRK in Art. 2 ausdrücklich das<br />
Recht auf Bildung festgeschrieben.<br />
Darin heißt es, das Recht auf Bildung<br />
darf niemandem verwehrt werden.<br />
Die zukünftige EU-Verfassung und<br />
EU Grundrechts-Charta (Art. 14):<br />
Nach Art. II-14 hat jeder Mensch ein<br />
Recht auf Bildung sowie auf Zugang<br />
zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung.<br />
Dieses Recht umfasst die<br />
Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht<br />
teilzunehmen (vgl. Art.<br />
II-14 EU-Verfassung). Somit wird auch<br />
im Rahmen der zukünftigen EU-Verfassung<br />
ein umfassendes Recht auf Bildung<br />
garantiert. Dabei soll die EU<br />
Grundrechts-Charter integraler<br />
Bestandteil der EU-Verfassung werden.<br />
Auch in der EU Grundrechts-<br />
Charter wird das Recht auf Bildung in<br />
Art. 14 I im oben genannten Sinne<br />
garantiert.<br />
2. Das Recht auf Bildung und<br />
Erziehung im Deutschen<br />
Verfassungsrecht<br />
Ein Recht auf Bildung ist nicht ausdrücklich<br />
in den Grundrechtskatalog<br />
des Grundgesetzes aufgenommen worden.<br />
Die Kodifizierung sozialer Grundrechte,<br />
insbesondere des Rechts auf<br />
Bildung, finden sich nur in einigen<br />
Länderverfassungen, wenngleich dieses<br />
Recht als Staatsziel und nicht als<br />
subjektives Recht ausgeformt ist. Auch<br />
der Parlamentarische Rat von 1948/49<br />
setzte sich zu Beginn der Grundrechtsdebatte<br />
mit der Frage auseinander, ob<br />
neben den klassischen Grundrechten<br />
nicht auch Grundrechte »sozialer Art«<br />
mit aufgenommen werden sollten. Es<br />
setzte sich jedoch die Auffassung<br />
durch, dass nur die klassischen individuellen<br />
Freiheitsrechte mit in den<br />
Grundrechtskatalog aufgenommen<br />
werden sollten. Regelungen der sogenannten<br />
Lebensordnung sollten nicht<br />
getroffen werden. Der soziale Bereich<br />
sollte auf die Staatszielbestimmungen<br />
des sozialen Bundes- und Rechtsstaats<br />
konzentriert werden (Art. 20 I GG und<br />
28 I 1 GG). Damit wurde die Idee<br />
sozialer Grundrechtsgehalte nicht aufgegeben,<br />
sondern ihre Realisierung in<br />
erster Linie auf den dazu berufenen<br />
Gesetzgeber verlagert. 166<br />
Art. 28 KRK<br />
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die<br />
Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit<br />
fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere<br />
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen;<br />
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender<br />
und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar<br />
und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der<br />
Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei<br />
Bedürftigkeit treffen;<br />
c) allen entsprechend den Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit<br />
allen geeigneten Mitteln ermöglichen;<br />
d) Bildungsberatung und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich<br />
machen;<br />
e) Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den<br />
Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern.<br />
(2) Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen,<br />
dass die Disziplin in der Schule in der Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde<br />
des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen<br />
steht.<br />
Der verfassungsrechtliche Rahmen:<br />
Das verfassungsrechtliche Spannungsverhältnis,<br />
in dem sich ein verfassungsmäßiges<br />
»Recht auf Bildung« oder<br />
zumindest Elemente eines solchen für<br />
die Gruppe der Flüchtlinge bewegt,<br />
setzt sich aus folgenden Komponenten<br />
des Grundgesetzes zusammen:<br />
• Art. 7 GG (Schulwesen): Das gesamte<br />
Schulwesen ist der Aufsicht des<br />
Staates unterworfen.<br />
• Art. 6 II GG (Ehe, Familie, nichteheliche<br />
Kinder): Das natürliche primär<br />
den Eltern zustehende Recht auf<br />
Pflege und Erziehung ihrer Kinder ist<br />
hier festgeschrieben. Dieses ist unter<br />
die Aufsicht des Staates gestellt.<br />
• Art. 2 I GG (Freie Entfaltung der<br />
Persönlichkeit) i.V.m. Art 1 I GG<br />
(Schutz der Menschenwürde) als<br />
sogenanntes allgemeines Persönlichkeitsrecht:<br />
Es schützt die engere persönliche<br />
Lebenssphäre.<br />
• Art. 2 I GG (Freie Entfaltung der<br />
Persönlichkeit): Es handelt sich um<br />
ein so genanntes Auffanggrundrecht.<br />
• Art. 3 I III GG (Gleichheit vor dem<br />
Gesetz): Der allgemeine Gleichheitssatz<br />
mit seinen Differenzierungsverboten<br />
in Absatz 3 (Geschlecht,<br />
Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat,<br />
Herkunft, Glauben, religiöse<br />
oder politische Anschauung) ist hier<br />
festgeschrieben.<br />
• Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes.<br />
Mit Art. 7 GG wird das Schulwesen<br />
der staatlichen Aufsicht unterstellt,<br />
unabhängig davon, ob es sich um eine<br />
private oder öffentliche Schule handelt.<br />
Die Vorschrift verpflichtet den<br />
Staat zu eigenen Anstrengungen, das<br />
Schulwesen nicht alleine den gesellschaftlichen<br />
Kräften zu überlassen,<br />
sondern im Ergebnis ein leistungsfähiges<br />
Schulwesen zu garantieren. Hierbei<br />
besteht ein weiter Ausgestaltungsspielraum<br />
seitens des Staates, wobei<br />
jedoch hinreichend leistungsfähige Bildungseinrichtungen<br />
für die gesamte<br />
Bevölkerung geschaffen werden müssen.<br />
167 Aus dem staatlichen Erziehungsauftrag<br />
folgert das Bundesverfassungsgericht<br />
die allgemeine Schulpflicht.<br />
Aus Art. 6 II 1 ergibt sich das primäre<br />
Erziehungsrecht der Eltern gegenüber<br />
ihren Kindern, das unter die Aufsicht<br />
des Staates gestellt ist. Die Erziehung<br />
liegt damit primär in der Verantwortung<br />
der Eltern, die grundsätzlich<br />
frei von staatlichen Einflüssen und<br />
Eingriffen nach den eigenen Vorstellungen<br />
darüber entscheiden können,<br />
wie sie ihrer Elternverantwortung<br />
gerecht werden wollen. Das Elternrecht<br />
ist zum Schutz des Kindes eingeräumt<br />
und hat allein dessen Wohl zu<br />
dienen. 168 Dabei ist es nicht nur auf die<br />
häusliche Erziehung beschränkt,<br />
wenngleich es dort seinen Schwerpunkt<br />
hat; die schulische Erziehung ist