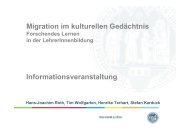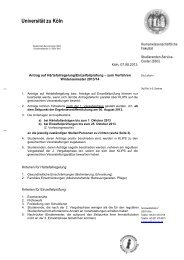Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Definitionsversuch von Kersten Reich, wagt die Abgrenzung zwischen den<br />
Begrifflichkeiten <strong>Inklusion</strong> und Integration zu verdeutlichen. Integration ermöglicht<br />
Menschen mit Behinderung an der Institution Schule teilzunehmen, während<br />
<strong>Inklusion</strong> sich an den Bedürfnissen jeder Schülerin und jedes Schülers orientiert. Es<br />
kommt nicht mehr darauf an, ob ein Mensch „sonderpädagogischen Förderbedarf“<br />
beansprucht oder nicht, sondern auf die Individualität jedes Einzelnen mit seinen<br />
Stärken. Neben der Abgrenzung zur Integration, gibt es noch weitere pädagogische<br />
Phasen der Förderung. Hinz unterscheidet insgesamt fünf Phasen<br />
(sonderpädagogischer) Förderung: „Extinktion, Exklusion, Segregation, Integration<br />
und <strong>Inklusion</strong>“ (Vgl. Hinz 2007, S.23ff.). Diese Phasen sind für ihn keine<br />
aufeinanderfolgenden Phasen, sondern jede Phase steht für sich und kann getrennt<br />
von den anderen Phasen stattfinden.<br />
In der Phase der Extinktion wird Menschen mit Behinderung ihr Lebensrecht<br />
abgesprochen. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Extinktion vernichtender<br />
Weise von Nationalsozialisten praktiziert. Millionen Juden und Menschen mit<br />
Behinderungen wurden um ihr Lebensrecht gebracht.<br />
In der Phase der Exklusion entwickeln sich zwei Gruppen: die eine findet Zugang zur<br />
Bildung und der anderen wird der Zugang zur Bildung verwehrt. In dieser Phase<br />
werden Menschen mit Behinderung als nicht bildungsfähig betrachtet bzw. von der<br />
Gesellschaft ausgeschlossen. Die Zustände für Menschen mit geistiger Behinderung<br />
Anfang des 19.Jahrhunderts, erweisen sich als ein Beispiel für „gesellschaftliche<br />
Exklusion“. Das gesellschaftliche Dasein von Menschen mit geistiger Behinderung<br />
in dieser Zeit beschreibt Barbara Fornefeld wie folgt: „Meist aber fristeten sie ein<br />
elendes gesellschaftliches Randdasein, angewiesen auf Almosen und abgeschoben in<br />
Klöstern, Armenhäusern […] oder verblieben in den Familien“( Fornefeld 2004,<br />
S.29).<br />
Auch in der Phase der Segregation bilden sich wiederum zwei Gruppen, dies wird in<br />
dieser Phase mit dem Begriff der „Zwei-Gruppen-Theorie“ beschrieben. Die „Zwei-<br />
Gruppen-Theorie“ teilt Menschen mit und Menschen ohne „sonderpädagogischen<br />
Förderbedarf“ in unterschiedliche Gruppen ein. Aus diesem Grund folgt die<br />
Beschulung der jeweiligen Gruppe in unterschiedlichen Institutionen. Diese Situation<br />
findet sich in Deutschland bis heute: dem Sonderschulsystem steht ein<br />
Regelschulsystem gegenüber. Schülerinnen und Schüler mit und ohne Förderbedarf<br />
werden größtenteils getrennt voneinander beschult, nur ca. 18% der Schülerinnen