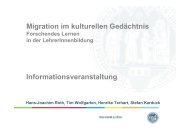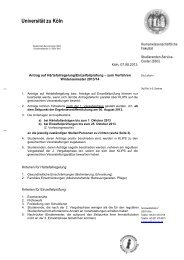Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die eine Seite fordert eine Doppelbesetzung in inklusiven Klassen, um allen Kindern<br />
gerecht werden zu könne. Die andere Seite argumentiert dagegen, dass eine<br />
Doppelbesetzung die Gefahr birgt, die Schülerinnen und Schüler in Förderkinder<br />
und Regelkinder zu teilen, statt gemeinsamen Unterricht zu ermöglichen (Vgl.<br />
Greiner 2013, S.2).<br />
Schülerinnen und Schüler mit „sonderpädagogischem<br />
Förderbedarf“ werden aus dem Klassenkontext heraus genommen, um dem Schüler<br />
oder der Schülerin ein spezifisches sonderpädagogisches Setting zur Verfügung zu<br />
stellen. Diese Form von Integration beinhaltet nach Wocken ein „didaktisches<br />
Grundproblem“ (Wocken 2011, S.9), weil in jedem Klassenkontext unterschiedliche<br />
Kinder mit unterschiedlichem Material versorgt werden müssten. Kinder mit<br />
„sonderpädagogischem Förderbedarf“, die getrennt von ihrer Stammklasse<br />
unterrichtet werden und andere Materialien bearbeiten, als die „nichtbehinderten“<br />
Schülerinnen und Schüler, können in Schwierigkeiten geraten, den Anschluss an die<br />
Klassengemeinschaft zu finden. Durch Einzelintegration in einem separaten<br />
Lernraum, bekommen diese Schüler den Eindruck ein Alleinstellungsmerkmal zu<br />
haben, was dazu führen kann, dass die „zwei-Gruppen-Theorie“ auch in einem<br />
integrativen Kontext bestehen bleibt. Eine Studie aus Norwegen hat sich dieser<br />
Thematik angenähert und zwei Schülergruppen miteinander verglichen. In der einen<br />
Gruppe wurden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf<br />
innerhalb der Klasse gefördert und in der zweiten Gruppe fand für diese<br />
Schülerinnen und Schüler eine Förderung außerhalb der Klasse statt (Vgl. Myklebust<br />
2002, S.251). Das Ergebnis der Studie lautet:<br />
Specially adapted teaching in ordinary classes during the first school year<br />
results in the best progress, but also the highest dropout. Specially adapted<br />
programmes outside ordinary classes result in the poorest progress […] but<br />
here the dropout is distinctly lower (ebd. S.261).<br />
Auf der einen Seite belegt dieses Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler in<br />
inklusiven Settings zu sehr guten Ergebnissen kommen, auf der anderen Seite steht<br />
diesem positiven Ergebnis eine hohe „Dropout-Rate“ gegenüber. Dies ist bei der<br />
Umsetzung von <strong>Inklusion</strong> zu beachten.<br />
Um <strong>Inklusion</strong> zu ermöglichen, muss es als eine weitergedachte Integration betrachtet<br />
werden. <strong>Inklusion</strong> kann als ein „gesellschaftliches Denkmodell“ gelten, indem alle<br />
Kinder angenommen werden wie sie sind, ohne sich an ein Schulsystem anpassen zu<br />
müssen. Nach Andreas Hinz beabsichtigt <strong>Inklusion</strong> ein selbstverständliches