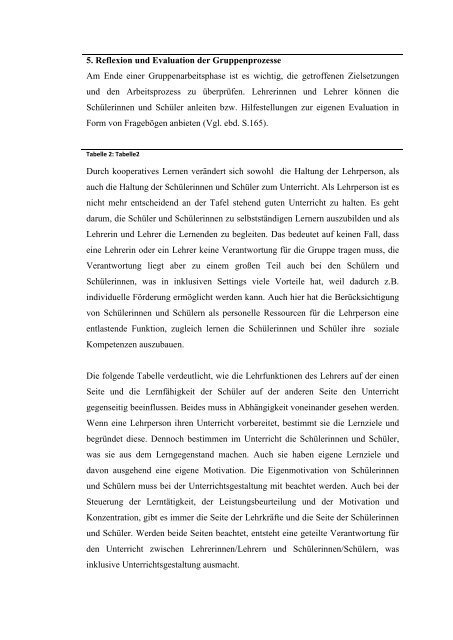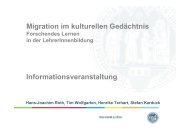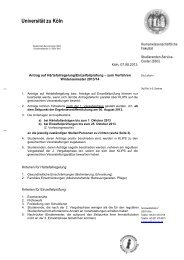Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
5. Reflexion und Evaluation der Gruppenprozesse<br />
Am Ende einer Gruppenarbeitsphase ist es wichtig, die getroffenen Zielsetzungen<br />
und den Arbeitsprozess zu überprüfen. Lehrerinnen und Lehrer können die<br />
Schülerinnen und Schüler anleiten bzw. Hilfestellungen zur eigenen Evaluation in<br />
Form von Fragebögen anbieten (Vgl. ebd. S.165).<br />
Tabelle 2: Tabelle2<br />
Durch kooperatives Lernen verändert sich sowohl die Haltung der Lehrperson, als<br />
auch die Haltung der Schülerinnen und Schüler zum Unterricht. Als Lehrperson ist es<br />
nicht mehr entscheidend an der Tafel stehend guten Unterricht zu halten. Es geht<br />
darum, die Schüler und Schülerinnen zu selbstständigen Lernern auszubilden und als<br />
Lehrerin und Lehrer die Lernenden zu begleiten. Das bedeutet auf keinen Fall, dass<br />
eine Lehrerin oder ein Lehrer keine Verantwortung für die Gruppe tragen muss, die<br />
Verantwortung liegt aber zu einem großen Teil auch bei den Schülern und<br />
Schülerinnen, was in inklusiven Settings viele Vorteile hat, weil dadurch z.B.<br />
individuelle Förderung ermöglicht werden kann. Auch hier hat die Berücksichtigung<br />
von Schülerinnen und Schülern als personelle Ressourcen für die Lehrperson eine<br />
entlastende Funktion, zugleich lernen die Schülerinnen und Schüler ihre soziale<br />
Kompetenzen auszubauen.<br />
Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie die Lehrfunktionen des Lehrers auf der einen<br />
Seite und die Lernfähigkeit der Schüler auf der anderen Seite den Unterricht<br />
gegenseitig beeinflussen. Beides muss in Abhängigkeit voneinander gesehen werden.<br />
Wenn eine Lehrperson ihren Unterricht vorbereitet, bestimmt sie die Lernziele und<br />
begründet diese. Dennoch bestimmen im Unterricht die Schülerinnen und Schüler,<br />
was sie aus dem Lerngegenstand machen. Auch sie haben eigene Lernziele und<br />
davon ausgehend eine eigene Motivation. Die Eigenmotivation von Schülerinnen<br />
und Schülern muss bei der Unterrichtsgestaltung mit beachtet werden. Auch bei der<br />
Steuerung der Lerntätigkeit, der Leistungsbeurteilung und der Motivation und<br />
Konzentration, gibt es immer die Seite der Lehrkräfte und die Seite der Schülerinnen<br />
und Schüler. Werden beide Seiten beachtet, entsteht eine geteilte Verantwortung für<br />
den Unterricht zwischen Lehrerinnen/Lehrern und Schülerinnen/Schülern, was<br />
inklusive Unterrichtsgestaltung ausmacht.