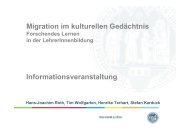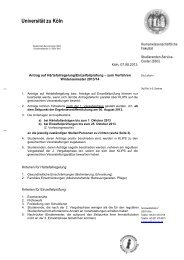Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Zunkunftsmodell Inklusion - Humanwissenschaftliche Fakultät
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
este Methode ist. Neben den Gruppenkonstellationen geht Wocken auf weitere<br />
Ziele ein, die durch kooperatives Lernen erreichet werden sollen.<br />
Ziele kooperativen Lernens<br />
1. Positive Interdependenz<br />
Positive Interdependenz kommt zustande, wenn alle Schülerinnen und Schüler einer<br />
Gruppe gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten (Vgl. ebd. S.164ff.). Am Ende einer<br />
gemeinsamen Gruppenphase wird nicht festgelegt, welche Gruppe sich am besten<br />
geschlagen hat, sondern hervorgehoben, dass alle gemeinsam für das Gelingen des<br />
Projektes verantwortlich sind. Dafür ist es unvermeidbar, die Strukturen der Projekte<br />
transparent zu halten. Lehrkräfte sind aufgefordert, vor einer Gruppenphase ihre<br />
persönlichen Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler zu richten. Gleichzeitig<br />
erfragen sie, welche Erwartungen die Schülerinnen und Schüler an ihr eigenes<br />
Projekt und an die Gruppe haben. Der Austausch von Erwartungen untereinander,<br />
ermöglicht jedes Mal eine hohe Transparenz, die für das Erreichen einer Zielsetzung<br />
von Bedeutung sein kann.<br />
2. Persönliche Verantwortlichkeit<br />
Kooperatives Lernen ist dann erfolgreich, wenn jedes Mitglied der Gruppe etwas auf<br />
dem Weg zum Ziel beigetragen hat (Vgl. ebd. S.165). Jeder Schüler und jede<br />
Schülerin der Gruppe muss einen Beitrag zum Projekt geleistet haben. Lehrpersonen<br />
haben die Aufgabe Schülerinnen und Schüler zur Aufgabenverteilung anzuregen.<br />
3.Direkte und förderliche Interaktionen<br />
Interaktionen innerhalb der Gruppe, machen kooperatives Lernen aus. In der Gruppe<br />
achtet jeder, auf einen freundlichen, sachlichen Umgang. Lehrerinnen und Lehrer<br />
haben die Aufgabe die Gruppen in ihrer Kommunikation zu unterstützen, wenn es<br />
nötig ist (Vgl. ebd. S.165).<br />
4. Kooperative Arbeitstechniken und soziale Kompetenzen<br />
Kooperative Arbeitstechniken und soziale Kompetenzen ergänzen den Punkt drei der<br />
direkten und förderlichen Interaktionen. Auch hier kann die Lehrperson Gruppen<br />
helfen, indem sie kooperative Arbeitstechniken vorstellt und vorschlägt. Die sozialen<br />
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern werden innerhalb des kooperativen<br />
Lernens immer wieder auf die Probe gestellt. Schülerinnen und Schüler müssen sich<br />
aufeinander einstellen, das fordert von dem einen viel Eingewöhnung für die andere<br />
gilt dies als eine Selbstverständlichkeit (Vgl. ebd. S.165).