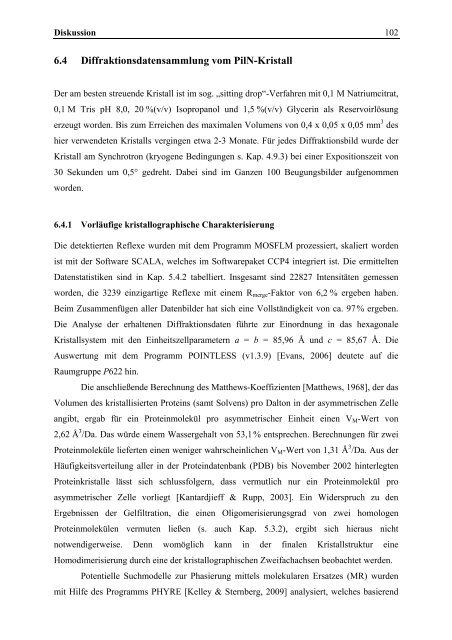Identifizierung und Charakterisierung von potentiellen ...
Identifizierung und Charakterisierung von potentiellen ...
Identifizierung und Charakterisierung von potentiellen ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Diskussion 102<br />
6.4 Diffraktionsdatensammlung vom PilN-Kristall<br />
Der am besten streuende Kristall ist im sog. „sitting drop“-Verfahren mit 0,1 M Natriumcitrat,<br />
0,1 M Tris pH 8,0, 20 %(v/v) Isopropanol <strong>und</strong> 1,5 %(v/v) Glycerin als Reservoirlösung<br />
erzeugt worden. Bis zum Erreichen des maximalen Volumens <strong>von</strong> 0,4 x 0,05 x 0,05 mm 3 des<br />
hier verwendeten Kristalls vergingen etwa 2-3 Monate. Für jedes Diffraktionsbild wurde der<br />
Kristall am Synchrotron (kryogene Bedingungen s. Kap. 4.9.3) bei einer Expositionszeit <strong>von</strong><br />
30 Sek<strong>und</strong>en um 0,5° gedreht. Dabei sind im Ganzen 100 Beugungsbilder aufgenommen<br />
worden.<br />
6.4.1 Vorläufige kristallographische <strong>Charakterisierung</strong><br />
Die detektierten Reflexe wurden mit dem Programm MOSFLM prozessiert, skaliert worden<br />
ist mit der Software SCALA, welches im Softwarepaket CCP4 integriert ist. Die ermittelten<br />
Datenstatistiken sind in Kap. 5.4.2 tabelliert. Insgesamt sind 22827 Intensitäten gemessen<br />
worden, die 3239 einzigartige Reflexe mit einem R merge -Faktor <strong>von</strong> 6,2 % ergeben haben.<br />
Beim Zusammenfügen aller Datenbilder hat sich eine Vollständigkeit <strong>von</strong> ca. 97 % ergeben.<br />
Die Analyse der erhaltenen Diffraktionsdaten führte zur Einordnung in das hexagonale<br />
Kristallsystem mit den Einheitszellparametern a = b = 85,96 Å <strong>und</strong> c = 85,67 Å. Die<br />
Auswertung mit dem Programm POINTLESS (v1.3.9) [Evans, 2006] deutete auf die<br />
Raumgruppe P622 hin.<br />
Die anschließende Berechnung des Matthews-Koeffizienten [Matthews, 1968], der das<br />
Volumen des kristallisierten Proteins (samt Solvens) pro Dalton in der asymmetrischen Zelle<br />
angibt, ergab für ein Proteinmolekül pro asymmetrischer Einheit einen V M -Wert <strong>von</strong><br />
2,62 Å 3 /Da. Das würde einem Wassergehalt <strong>von</strong> 53,1 % entsprechen. Berechnungen für zwei<br />
Proteinmoleküle lieferten einen weniger wahrscheinlichen V M -Wert <strong>von</strong> 1,31 Å 3 /Da. Aus der<br />
Häufigkeitsverteilung aller in der Proteindatenbank (PDB) bis November 2002 hinterlegten<br />
Proteinkristalle lässt sich schlussfolgern, dass vermutlich nur ein Proteinmolekül pro<br />
asymmetrischer Zelle vorliegt [Kantardjieff & Rupp, 2003]. Ein Widerspruch zu den<br />
Ergebnissen der Gelfiltration, die einen Oligomerisierungsgrad <strong>von</strong> zwei homologen<br />
Proteinmolekülen vermuten ließen (s. auch Kap. 5.3.2), ergibt sich hieraus nicht<br />
notwendigerweise. Denn womöglich kann in der finalen Kristallstruktur eine<br />
Homodimerisierung durch eine der kristallographischen Zweifachachsen beobachtet werden.<br />
Potentielle Suchmodelle zur Phasierung mittels molekularen Ersatzes (MR) wurden<br />
mit Hilfe des Programms PHYRE [Kelley & Sternberg, 2009] analysiert, welches basierend