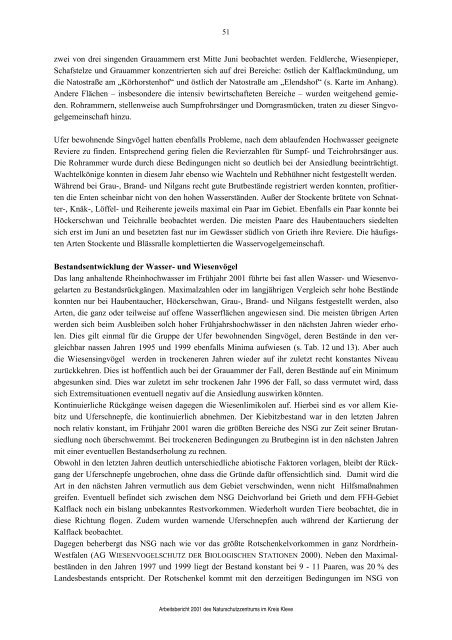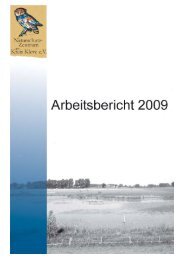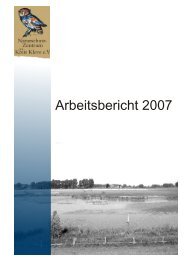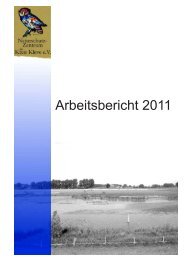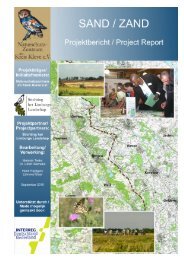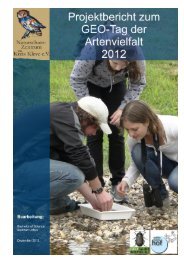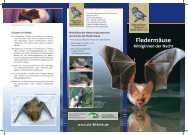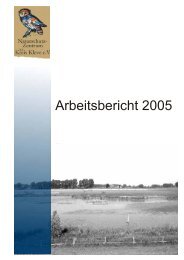Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
51<br />
zwei von drei singenden Grauammern erst Mitte Juni beobachtet werden. Feldlerche, Wiesenpieper,<br />
Schafstelze und Grauammer konzentrierten sich auf drei Bereiche: östlich der Kalflackmündung, um<br />
die Natostraße am „Körhorstenhof“ und östlich der Natostraße am „Elendshof“ (s. Karte im Anhang).<br />
Andere Flächen – insbesondere die intensiv bewirtschafteten Bereiche – wurden weitgehend gemieden.<br />
Rohrammern, stellenweise auch Sumpfrohrsänger und Dorngrasmücken, traten zu dieser Singvogelgemeinschaft<br />
hinzu.<br />
Ufer bewohnende Singvögel hatten ebenfalls Probleme, nach dem ablaufenden Hochwasser geeignete<br />
Reviere zu finden. Entsprechend gering fielen die Revierzahlen für Sumpf- und Teichrohrsänger aus.<br />
Die Rohrammer wurde durch diese Bedingungen nicht so deutlich bei der Ansiedlung beeinträchtigt.<br />
Wachtelkönige konnten in diesem Jahr ebenso wie Wachteln und Rebhühner nicht festgestellt werden.<br />
Während bei Grau-, Brand- und Nilgans recht gute Brutbestände registriert werden konnten, profitierten<br />
die Enten scheinbar nicht von den hohen Wasserständen. Außer der Stockente brütete von Schnatter-,<br />
Knäk-, Löffel- und Reiherente jeweils maximal ein Paar im Gebiet. Ebenfalls ein Paar konnte bei<br />
Höckerschwan und Teichralle beobachtet werden. Die meisten Paare des Haubentauchers siedelten<br />
sich erst im Juni an und besetzten fast nur im Gewässer südlich von Grieth ihre Reviere. Die häufigsten<br />
Arten Stockente und Blässralle komplettierten die Wasservogelgemeinschaft.<br />
Bestandsentwicklung der Wasser- und Wiesenvögel<br />
Das lang anhaltende Rheinhochwasser im Frühjahr 2001 führte bei fast allen Wasser- und Wiesenvogelarten<br />
zu Bestandsrückgängen. Maximalzahlen oder im langjährigen Vergleich sehr hohe Bestände<br />
konnten nur bei Haubentaucher, Höckerschwan, Grau-, Brand- und Nilgans festgestellt werden, also<br />
Arten, die ganz oder teilweise auf offene Wasserflächen angewiesen sind. Die meisten übrigen Arten<br />
werden sich beim Ausbleiben solch hoher Frühjahrshochwässer in den nächsten Jahren wieder erholen.<br />
Dies gilt einmal für die Gruppe der Ufer bewohnenden Singvögel, deren Bestände in den vergleichbar<br />
nassen Jahren 1995 und 1999 ebenfalls Minima aufwiesen (s. Tab. 12 und 13). Aber auch<br />
die Wiesensingvögel werden in trockeneren Jahren wieder auf ihr zuletzt recht konstantes Niveau<br />
zurückkehren. Dies ist hoffentlich auch bei der Grauammer der Fall, deren Bestände auf ein Minimum<br />
abgesunken sind. Dies war zuletzt im sehr trockenen Jahr 1996 der Fall, so dass vermutet wird, dass<br />
sich Extremsituationen eventuell negativ auf die Ansiedlung auswirken könnten.<br />
Kontinuierliche Rückgänge weisen dagegen die Wiesenlimikolen auf. Hierbei sind es vor allem Kiebitz<br />
und Uferschnepfe, die kontinuierlich abnehmen. Der Kiebitzbestand war in den letzten Jahren<br />
noch relativ konstant, im Frühjahr 2001 waren die größten Bereiche des NSG zur Zeit seiner Brutansiedlung<br />
noch überschwemmt. Bei trockeneren Bedingungen zu Brutbeginn ist in den nächsten Jahren<br />
mit einer eventuellen Bestandserholung zu rechnen.<br />
Obwohl in den letzten Jahren deutlich unterschiedliche abiotische Faktoren vorlagen, bleibt der Rückgang<br />
der Uferschnepfe ungebrochen, ohne dass die Gründe dafür offensichtlich sind. Damit wird die<br />
Art in den nächsten Jahren vermutlich aus dem Gebiet verschwinden, wenn nicht Hilfsmaßnahmen<br />
greifen. Eventuell befindet sich zwischen dem NSG Deichvorland bei Grieth und dem FFH-Gebiet<br />
Kalflack noch ein bislang unbekanntes Restvorkommen. Wiederholt wurden Tiere beobachtet, die in<br />
diese Richtung flogen. Zudem wurden warnende Uferschnepfen auch während der Kartierung der<br />
Kalflack beobachtet.<br />
Dagegen beherbergt das NSG nach wie vor das größte Rotschenkelvorkommen in ganz Nordrhein-<br />
Westfalen (AG WIESENVOGELSCHUTZ DER BIOLOGISCHEN STATIONEN 2000). Neben den Maximalbeständen<br />
in den Jahren 1997 und 1999 liegt der Bestand konstant bei 9 - 11 Paaren, was 20 % des<br />
Landesbestands entspricht. Der Rotschenkel kommt mit den derzeitigen Bedingungen im NSG von<br />
Arbeitsbericht 2001 des <strong>Naturschutzzentrum</strong>s im Kreis <strong>Kleve</strong>