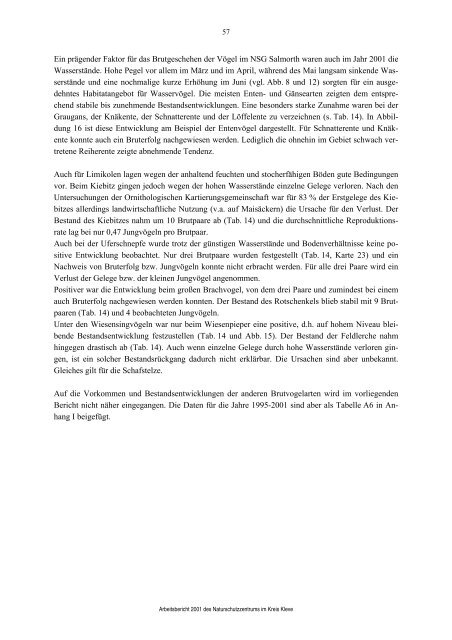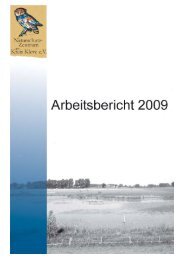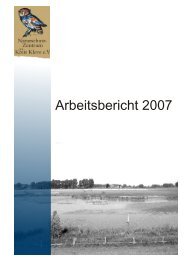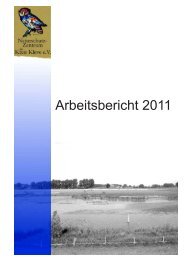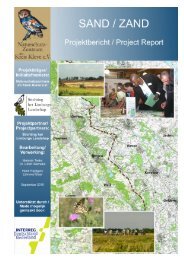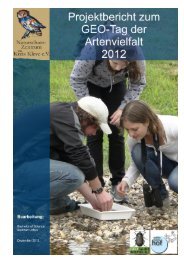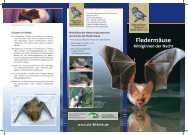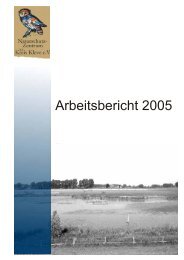Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
57<br />
Ein prägender Faktor für das Brutgeschehen der Vögel im NSG Salmorth waren auch im Jahr 2001 die<br />
Wasserstände. Hohe Pegel vor allem im März und im April, während des Mai langsam sinkende Wasserstände<br />
und eine nochmalige kurze Erhöhung im Juni (vgl. Abb. 8 und 12) sorgten für ein ausgedehntes<br />
Habitatangebot für Wasservögel. Die meisten Enten- und Gänsearten zeigten dem entsprechend<br />
stabile bis zunehmende Bestandsentwicklungen. Eine besonders starke Zunahme waren bei der<br />
Graugans, der Knäkente, der Schnatterente und der Löffelente zu verzeichnen (s. Tab. 14). In Abbildung<br />
16 ist diese Entwicklung am Beispiel der Entenvögel dargestellt. Für Schnatterente und Knäkente<br />
konnte auch ein Bruterfolg nachgewiesen werden. Lediglich die ohnehin im Gebiet schwach vertretene<br />
Reiherente zeigte abnehmende Tendenz.<br />
Auch für Limikolen lagen wegen der anhaltend feuchten und stocherfähigen Böden gute Bedingungen<br />
vor. Beim Kiebitz gingen jedoch wegen der hohen Wasserstände einzelne Gelege verloren. Nach den<br />
Untersuchungen der Ornithologischen Kartierungsgemeinschaft war für 83 % der Erstgelege des Kiebitzes<br />
allerdings landwirtschaftliche Nutzung (v.a. auf Maisäckern) die Ursache für den Verlust. Der<br />
Bestand des Kiebitzes nahm um 10 Brutpaare ab (Tab. 14) und die durchschnittliche Reproduktionsrate<br />
lag bei nur 0,47 Jungvögeln pro Brutpaar.<br />
Auch bei der Uferschnepfe wurde trotz der günstigen Wasserstände und Bodenverhältnisse keine positive<br />
Entwicklung beobachtet. Nur drei Brutpaare wurden festgestellt (Tab. 14, Karte 23) und ein<br />
Nachweis von Bruterfolg bzw. Jungvögeln konnte nicht erbracht werden. Für alle drei Paare wird ein<br />
Verlust der Gelege bzw. der kleinen Jungvögel angenommen.<br />
Positiver war die Entwicklung beim großen Brachvogel, von dem drei Paare und zumindest bei einem<br />
auch Bruterfolg nachgewiesen werden konnten. Der Bestand des Rotschenkels blieb stabil mit 9 Brutpaaren<br />
(Tab. 14) und 4 beobachteten Jungvögeln.<br />
Unter den Wiesensingvögeln war nur beim Wiesenpieper eine positive, d.h. auf hohem Niveau bleibende<br />
Bestandsentwicklung festzustellen (Tab. 14 und Abb. 15). Der Bestand der Feldlerche nahm<br />
hingegen drastisch ab (Tab. 14). Auch wenn einzelne Gelege durch hohe Wasserstände verloren gingen,<br />
ist ein solcher Bestandsrückgang dadurch nicht erklärbar. Die Ursachen sind aber unbekannt.<br />
Gleiches gilt für die Schafstelze.<br />
Auf die Vorkommen und Bestandsentwicklungen der anderen Brutvogelarten wird im vorliegenden<br />
Bericht nicht näher eingegangen. Die Daten für die Jahre 1995-2001 sind aber als Tabelle A6 in Anhang<br />
I beigefügt.<br />
Arbeitsbericht 2001 des <strong>Naturschutzzentrum</strong>s im Kreis <strong>Kleve</strong>