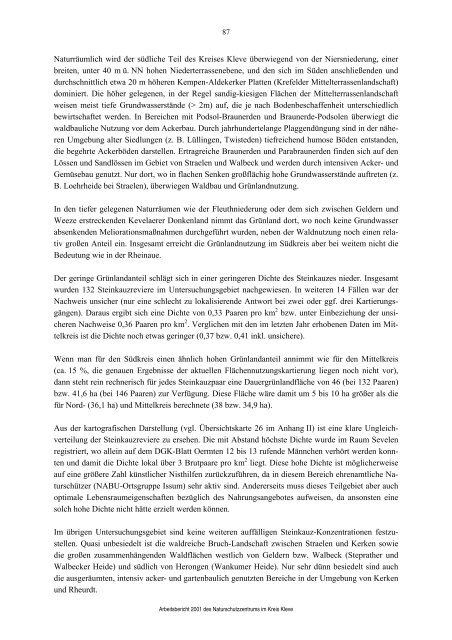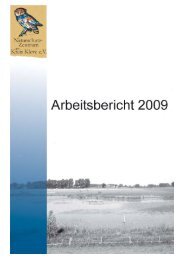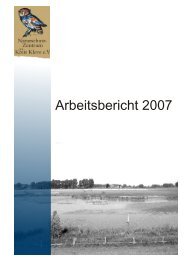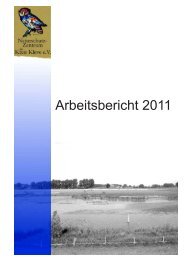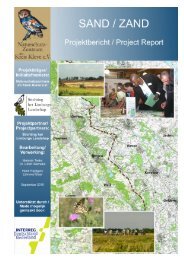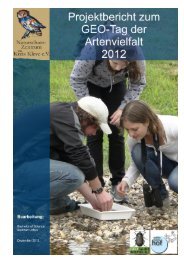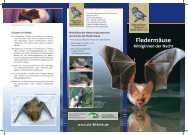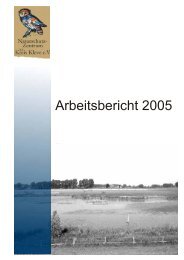Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
87<br />
Naturräumlich wird der südliche Teil des Kreises <strong>Kleve</strong> überwiegend von der Niersniederung, einer<br />
breiten, unter 40 m ü. NN hohen Niederterrassenebene, und den sich im Süden anschließenden und<br />
durchschnittlich etwa 20 m höheren Kempen-Aldekerker Platten (Krefelder Mittelterrassenlandschaft)<br />
dominiert. Die höher gelegenen, in der Regel sandig-kiesigen Flächen der Mittelterrassenlandschaft<br />
weisen meist tiefe Grundwasserstände (> 2m) auf, die je nach Bodenbeschaffenheit unterschiedlich<br />
bewirtschaftet werden. In Bereichen mit Podsol-Braunerden und Braunerde-Podsolen überwiegt die<br />
waldbauliche Nutzung vor dem Ackerbau. Durch jahrhundertelange Plaggendüngung sind in der näheren<br />
Umgebung alter Siedlungen (z. B. Lüllingen, Twisteden) tiefreichend humose Böden entstanden,<br />
die begehrte Ackerböden darstellen. Ertragreiche Braunerden und Parabraunerden finden sich auf den<br />
Lössen und Sandlössen im Gebiet von Straelen und Walbeck und werden durch intensiven Acker- und<br />
Gemüsebau genutzt. Nur dort, wo in flachen Senken großflächig hohe Grundwasserstände auftreten (z.<br />
B. Loehrheide bei Straelen), überwiegen Waldbau und Grünlandnutzung.<br />
In den tiefer gelegenen Naturräumen wie der Fleuthniederung oder dem sich zwischen Geldern und<br />
Weeze erstreckenden Kevelaerer Donkenland nimmt das Grünland dort, wo noch keine Grundwasser<br />
absenkenden Meliorationsmaßnahmen durchgeführt wurden, neben der Waldnutzung noch einen relativ<br />
großen Anteil ein. Insgesamt erreicht die Grünlandnutzung im Südkreis aber bei weitem nicht die<br />
Bedeutung wie in der Rheinaue.<br />
Der geringe Grünlandanteil schlägt sich in einer geringeren Dichte des Steinkauzes nieder. Insgesamt<br />
wurden 132 Steinkauzreviere im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. In weiteren 14 Fällen war der<br />
Nachweis unsicher (nur eine schlecht zu lokalisierende Antwort bei zwei oder ggf. drei Kartierungsgängen).<br />
Daraus ergibt sich eine Dichte von 0,33 Paaren pro km 2 bzw. unter Einbeziehung der unsicheren<br />
Nachweise 0,36 Paaren pro km 2 . Verglichen mit den im letzten Jahr erhobenen Daten im Mittelkreis<br />
ist die Dichte noch etwas geringer (0,37 bzw. 0,41 inkl. unsichere).<br />
Wenn man für den Südkreis einen ähnlich hohen Grünlandanteil annimmt wie für den Mittelkreis<br />
(ca. 15 %, die genauen Ergebnisse der aktuellen Flächennutzungskartierung liegen noch nicht vor),<br />
dann steht rein rechnerisch für jedes Steinkauzpaar eine Dauergrünlandfläche von 46 (bei 132 Paaren)<br />
bzw. 41,6 ha (bei 146 Paaren) zur Verfügung. Diese Fläche wäre damit um 5 bis 10 ha größer als die<br />
für Nord- (36,1 ha) und Mittelkreis berechnete (38 bzw. 34,9 ha).<br />
Aus der kartografischen Darstellung (vgl. Übersichtskarte 26 im Anhang II) ist eine klare Ungleichverteilung<br />
der Steinkauzreviere zu ersehen. Die mit Abstand höchste Dichte wurde im Raum Sevelen<br />
registriert, wo allein auf dem DGK-Blatt Oermten 12 bis 13 rufende Männchen verhört werden konnten<br />
und damit die Dichte lokal über 3 Brutpaare pro km 2 liegt. Diese hohe Dichte ist möglicherweise<br />
auf eine größere Zahl künstlicher Nisthilfen zurückzuführen, da in diesem Bereich ehrenamtliche Naturschützer<br />
(NABU-Ortsgruppe Issum) sehr aktiv sind. Andererseits muss dieses Teilgebiet aber auch<br />
optimale Lebensraumeigenschaften bezüglich des Nahrungsangebotes aufweisen, da ansonsten eine<br />
solch hohe Dichte nicht hätte erzielt werden können.<br />
Im übrigen Untersuchungsgebiet sind keine weiteren auffälligen Steinkauz-Konzentrationen festzustellen.<br />
Quasi unbesiedelt ist die waldreiche Bruch-Landschaft zwischen Straelen und Kerken sowie<br />
die großen zusammenhängenden Waldflächen westlich von Geldern bzw. Walbeck (Steprather und<br />
Walbecker Heide) und südlich von Herongen (Wankumer Heide). Nur sehr dünn besiedelt sind auch<br />
die ausgeräumten, intensiv acker- und gartenbaulich genutzten Bereiche in der Umgebung von Kerken<br />
und Rheurdt.<br />
Arbeitsbericht 2001 des <strong>Naturschutzzentrum</strong>s im Kreis <strong>Kleve</strong>