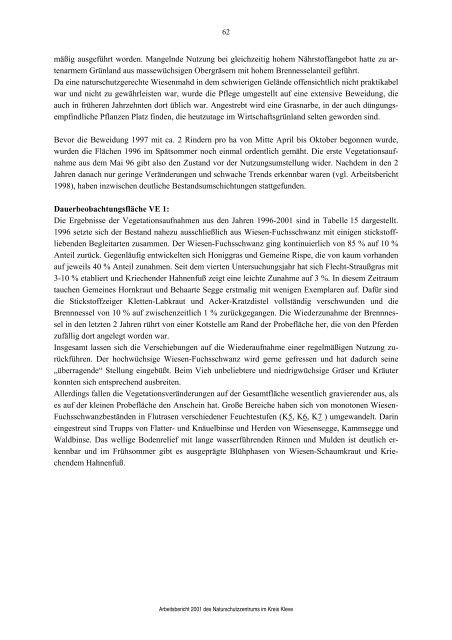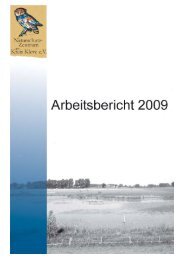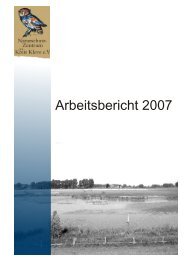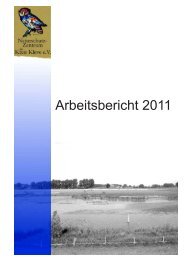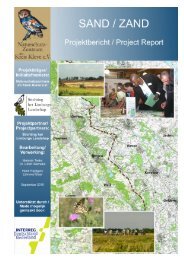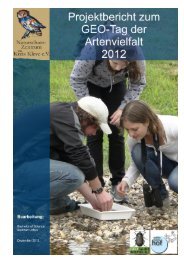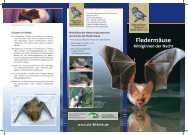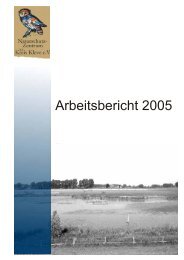Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
62<br />
mäßig ausgeführt worden. Mangelnde Nutzung bei gleichzeitig hohem Nährstoffangebot hatte zu artenarmem<br />
Grünland aus massewüchsigen Obergräsern mit hohem Brennesselanteil geführt.<br />
Da eine naturschutzgerechte Wiesenmahd in dem schwierigen Gelände offensichtlich nicht praktikabel<br />
war und nicht zu gewährleisten war, wurde die Pflege umgestellt auf eine extensive Beweidung, die<br />
auch in früheren Jahrzehnten dort üblich war. Angestrebt wird eine Grasnarbe, in der auch düngungsempfindliche<br />
Pflanzen Platz finden, die heutzutage im Wirtschaftsgrünland selten geworden sind.<br />
Bevor die Beweidung 1997 mit ca. 2 Rindern pro ha von Mitte April bis Oktober begonnen wurde,<br />
wurden die Flächen 1996 im Spätsommer noch einmal ordentlich gemäht. Die erste Vegetationsaufnahme<br />
aus dem Mai 96 gibt also den Zustand vor der Nutzungsumstellung wider. Nachdem in den 2<br />
Jahren danach nur geringe Veränderungen und schwache Trends erkennbar waren (vgl. Arbeitsbericht<br />
1998), haben inzwischen deutliche Bestandsumschichtungen stattgefunden.<br />
Dauerbeobachtungsfläche VE 1:<br />
Die Ergebnisse der Vegetationsaufnahmen aus den Jahren 1996-2001 sind in Tabelle 15 dargestellt.<br />
1996 setzte sich der Bestand nahezu ausschließlich aus Wiesen-Fuchsschwanz mit einigen stickstoffliebenden<br />
Begleitarten zusammen. Der Wiesen-Fuchsschwanz ging kontinuierlich von 85 % auf 10 %<br />
Anteil zurück. Gegenläufig entwickelten sich Honiggras und Gemeine Rispe, die von kaum vorhanden<br />
auf jeweils 40 % Anteil zunahmen. Seit dem vierten Untersuchungsjahr hat sich Flecht-Straußgras mit<br />
3-10 % etabliert und Kriechender Hahnenfuß zeigt eine leichte Zunahme auf 3 %. In diesem Zeitraum<br />
tauchen Gemeines Hornkraut und Behaarte Segge erstmalig mit wenigen Exemplaren auf. Dafür sind<br />
die Stickstoffzeiger Kletten-Labkraut und Acker-Kratzdistel vollständig verschwunden und die<br />
Brennnessel von 10 % auf zwischenzeitlich 1 % zurückgegangen. Die Wiederzunahme der Brennnessel<br />
in den letzten 2 Jahren rührt von einer Kotstelle am Rand der Probefläche her, die von den Pferden<br />
zufällig dort angelegt worden war.<br />
Insgesamt lassen sich die Verschiebungen auf die Wiederaufnahme einer regelmäßigen Nutzung zurückführen.<br />
Der hochwüchsige Wiesen-Fuchsschwanz wird gerne gefressen und hat dadurch seine<br />
„überragende“ Stellung eingebüßt. Beim Vieh unbeliebtere und niedrigwüchsige Gräser und Kräuter<br />
konnten sich entsprechend ausbreiten.<br />
Allerdings fallen die Vegetationsveränderungen auf der Gesamtfläche wesentlich gravierender aus, als<br />
es auf der kleinen Probefläche den Anschein hat. Große Bereiche haben sich von monotonen Wiesen-<br />
Fuchsschwanzbeständen in Flutrasen verschiedener Feuchtestufen (K5, K6, K7 ) umgewandelt. Darin<br />
eingestreut sind Trupps von Flatter- und Knäuelbinse und Herden von Wiesensegge, Kammsegge und<br />
Waldbinse. Das wellige Bodenrelief mit lange wasserführenden Rinnen und Mulden ist deutlich erkennbar<br />
und im Frühsommer gibt es ausgeprägte Blühphasen von Wiesen-Schaumkraut und Kriechendem<br />
Hahnenfuß.<br />
Arbeitsbericht 2001 des <strong>Naturschutzzentrum</strong>s im Kreis <strong>Kleve</strong>