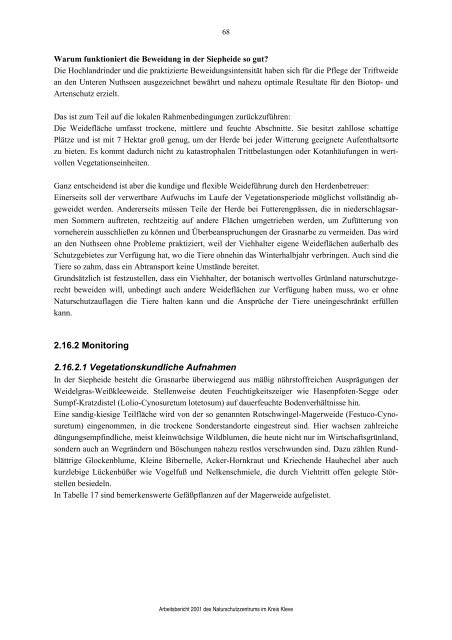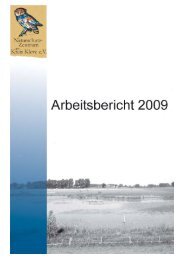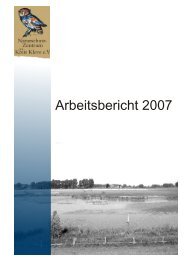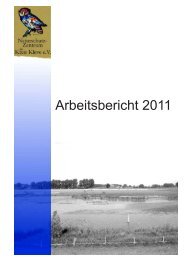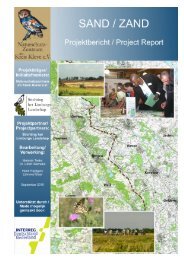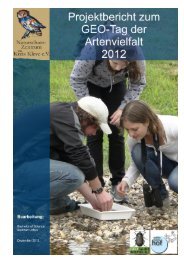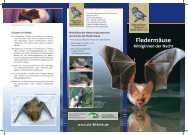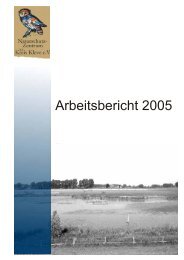Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Inhaltsverzeichnis - Naturschutzzentrum Kleve
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
68<br />
Warum funktioniert die Beweidung in der Siepheide so gut?<br />
Die Hochlandrinder und die praktizierte Beweidungsintensität haben sich für die Pflege der Triftweide<br />
an den Unteren Nuthseen ausgezeichnet bewährt und nahezu optimale Resultate für den Biotop- und<br />
Artenschutz erzielt.<br />
Das ist zum Teil auf die lokalen Rahmenbedingungen zurückzuführen:<br />
Die Weidefläche umfasst trockene, mittlere und feuchte Abschnitte. Sie besitzt zahllose schattige<br />
Plätze und ist mit 7 Hektar groß genug, um der Herde bei jeder Witterung geeignete Aufenthaltsorte<br />
zu bieten. Es kommt dadurch nicht zu katastrophalen Trittbelastungen oder Kotanhäufungen in wertvollen<br />
Vegetationseinheiten.<br />
Ganz entscheidend ist aber die kundige und flexible Weideführung durch den Herdenbetreuer:<br />
Einerseits soll der verwertbare Aufwuchs im Laufe der Vegetationsperiode möglichst vollständig abgeweidet<br />
werden. Andererseits müssen Teile der Herde bei Futterengpässen, die in niederschlagsarmen<br />
Sommern auftreten, rechtzeitig auf andere Flächen umgetrieben werden, um Zufütterung von<br />
vorneherein ausschließen zu können und Überbeanspruchungen der Grasnarbe zu vermeiden. Das wird<br />
an den Nuthseen ohne Probleme praktiziert, weil der Viehhalter eigene Weideflächen außerhalb des<br />
Schutzgebietes zur Verfügung hat, wo die Tiere ohnehin das Winterhalbjahr verbringen. Auch sind die<br />
Tiere so zahm, dass ein Abtransport keine Umstände bereitet.<br />
Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein Viehhalter, der botanisch wertvolles Grünland naturschutzgerecht<br />
beweiden will, unbedingt auch andere Weideflächen zur Verfügung haben muss, wo er ohne<br />
Naturschutzauflagen die Tiere halten kann und die Ansprüche der Tiere uneingeschränkt erfüllen<br />
kann.<br />
2.16.2 Monitoring<br />
2.16.2.1 Vegetationskundliche Aufnahmen<br />
In der Siepheide besteht die Grasnarbe überwiegend aus mäßig nährstoffreichen Ausprägungen der<br />
Weidelgras-Weißkleeweide. Stellenweise deuten Feuchtigkeitszeiger wie Hasenpfoten-Segge oder<br />
Sumpf-Kratzdistel (Lolio-Cynosuretum lotetosum) auf dauerfeuchte Bodenverhältnisse hin.<br />
Eine sandig-kiesige Teilfläche wird von der so genannten Rotschwingel-Magerweide (Festuco-Cynosuretum)<br />
eingenommen, in die trockene Sonderstandorte eingestreut sind. Hier wachsen zahlreiche<br />
düngungsempfindliche, meist kleinwüchsige Wildblumen, die heute nicht nur im Wirtschaftsgrünland,<br />
sondern auch an Wegrändern und Böschungen nahezu restlos verschwunden sind. Dazu zählen Rundblättrige<br />
Glockenblume, Kleine Bibernelle, Acker-Hornkraut und Kriechende Hauhechel aber auch<br />
kurzlebige Lückenbüßer wie Vogelfuß und Nelkenschmiele, die durch Viehtritt offen gelegte Störstellen<br />
besiedeln.<br />
In Tabelle 17 sind bemerkenswerte Gefäßpflanzen auf der Magerweide aufgelistet.<br />
Arbeitsbericht 2001 des <strong>Naturschutzzentrum</strong>s im Kreis <strong>Kleve</strong>