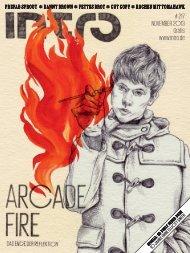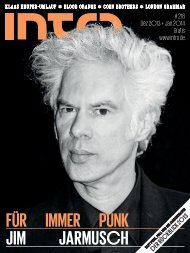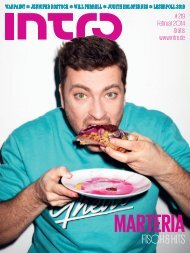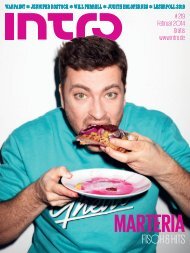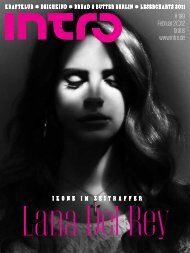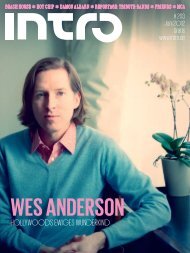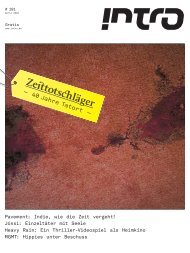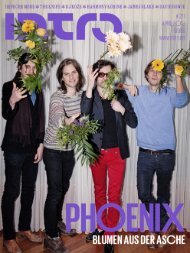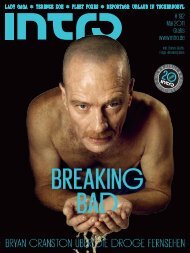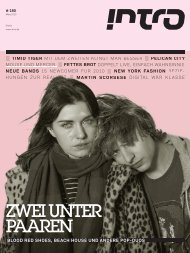sowie als PDF (Download 24,61 MB) - Intro
sowie als PDF (Download 24,61 MB) - Intro
sowie als PDF (Download 24,61 MB) - Intro
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
American Gothic<br />
Ein Blick auf die Besetzungsliste – Yvonne<br />
De Carlo, hauptsächlich bekannt <strong>als</strong><br />
Lily Munster, und der ebenfalls bei seiner<br />
Rollenauswahl nicht immer stilsichere<br />
Rod Steiger – lässt schon erahnen, dass<br />
es sich bei »American Gothic« um eines<br />
jener Horror-B-Filmchen handelt, von denen<br />
alternde Trashfans auf Sammlerbörsen<br />
kichernd berichten. Eine Gruppe junger<br />
Leute bricht voller Vorfreude zu einem<br />
Campingwochenende auf, um der frisch<br />
aus der Psychiatrie entlassenen Cynthia<br />
ein paar idyllische Tage zu bereiten.<br />
Ihr Flugzeug ist allerdings schon bald gezwungen<br />
notzuwassern, und so strandet<br />
die Gruppe auf einer abgelegenen Insel.<br />
Die einzigen Bewohner sind ein nach den<br />
puritanischen Idealen der Pilgerväter lebendes<br />
altes Ehepaar (Steiger & De Carlo),<br />
das sich zunächst <strong>als</strong> recht gastfreundlich<br />
und hilfsbereit erweist. Doch im altertümlichen<br />
Farmhaus trifft die Gruppe<br />
auf die Kinder des bibeltreuen Paares:<br />
drei Mittfünfziger, die sich benehmen<br />
und kleiden wie Kleinkinder und <strong>als</strong> Puppe<br />
eine Babyleiche herumtragen. Nicht<br />
nur vom Schulhof weiß man, wie grausam<br />
Kinder sein können, und so nimmt das irre<br />
Meucheln – u. a. mithilfe einer Schaukel<br />
– auf der Insel seinen nicht jugendfreien<br />
Gang. Amen. Der 1988 entstandene Film<br />
von Regisseur John Hough ist im Grunde<br />
ein typischer 80-Jahre-Slasher, der –<br />
angereichert um einige genreübliche Hinterwäldler-Stereotypien<br />
– <strong>als</strong> Horror-Parabel<br />
zu funktionieren versucht, inhaltlich<br />
aber nur selten die Qualitäten seiner<br />
ausgesprochenen Vorbilder, etwa Tobe<br />
Hoopers »Texas Chainsaw Massacre«,<br />
erreicht. Für Freunde des Genres ist diese<br />
DVD-Erstveröffentlichung aber sicher<br />
eine der Wiederentdeckungen des ersten<br />
Halbjahres.<br />
Cay Clasen<br />
American Gothic (GB/CAN 1988; R: John Hough;<br />
D: Yvonne De Carlo; Kinowelt Home Entertainment)<br />
ER NERVT, ABER ...<br />
J a, der Michael Moore: der Held der kleinen<br />
Leute, der mit seinem Film über den Verfall<br />
der Autoindustrie im Allgemeinen und die Firma<br />
Ford im Besonderen zum neuen Stern am<br />
Doku-Filmer-Himmel aufstieg und fortan <strong>als</strong> Sinnbild des<br />
kämpferischen Amerikaners mit dem Herz am rechten<br />
Fleck galt. Moore ist zum Opfer seiner eigenen Popularität<br />
geworden – sowohl seines moralischen <strong>als</strong> auch seines<br />
finanziellen Erfolgs. »Bowling For Columbine« wurde<br />
allerorts noch <strong>als</strong> mutiges Stück Kino gefeiert, doch »Fahrenheit<br />
9/11« ging der Medienmaschinerie dann doch ein<br />
bisschen zu weit. Und <strong>als</strong> sie angeworfen wurde, um Moore<br />
mit negativer Propaganda zu überhäufen, war es eigentlich<br />
schon geschehen um den ehemaligen Sympathieträger.<br />
Vielleicht hat er seine Medienpräsenz, gerade auch in<br />
Deutschland, ein wenig überzogen. Auf jeden Fall wollte<br />
ihn keiner mehr so recht ernst nehmen, <strong>als</strong> im letzten Jahr<br />
»Sicko« in die Kinos kam. Und außerdem: Was interessiert<br />
uns das amerikanische Gesundheitswesen?<br />
Diese negative Rezeption ist eine Schande, denn obwohl<br />
»Sicko« natürlich auch ein plakativer Film ist – anders<br />
kann Moore nicht erzählen –, ist von großem Interesse, wie<br />
er die Wurzel der gesellschaftlichen Missstände Amerikas<br />
am Verfall des Gesundheitssystems festmacht. Spannend<br />
wie ein Politthriller ist dieser Film inszeniert. Gerade <strong>als</strong><br />
Europäer gewinnt man einen guten Eindruck davon, was<br />
es bedeutet, auch in einem freien Land zum Sklaven eines<br />
Staates zu werden, der sich um seine Bürger einen Dreck<br />
schert und ihnen nicht einmal das in Deutschland selbstverständliche<br />
Grundrecht auf medizinische Versorgung<br />
DVD 067<br />
Michael Moore hat sich mit der Art, seine Filme zu drehen und zu präsentieren, nicht nur<br />
Freunde gemacht. Als »Sicko« in die Kinos kam, hatte er es sich mit dem Großteil der Kritik<br />
nicht ganz ohne Grund verscherzt. Sascha Seiler mag ihn trotzdem nicht abschreiben.<br />
Borderline<br />
In Cheryl Dunyes »The Watermelon Woman« (1995), einem<br />
Klassiker des »queer cinema«, begeben sich die Protagonistinnen<br />
auf die Spuren einer lesbischen, afroamerikanischen<br />
Schauspielerin aus den 1930er-Jahren, die ein<br />
Verhältnis mit ihrer weißen Regisseurin hatte. Doch am<br />
Ende des Films platzt die Blase: Die ominöse »Watermelon<br />
Woman« hat es nie gegeben, die Protagonistinnen haben<br />
sie für ihren Pseudo-Dokumentarfilm lediglich erfunden,<br />
weil es zu schön gewesen wäre, wenn es so etwas schon<br />
in den 1930er-Jahren gegeben hätte. Ähnlich funktioniert<br />
Kenneth Macphersons »Borderline« (1930). Handlung und<br />
Machart sind für die Entstehungszeit so ungewöhnlich,<br />
dass man verdutzt die Augen reibt: Ist hier etwa der große<br />
Stummfilm-Faker Guy Maddin am Werk? Nein, es handelt<br />
sich tatsächlich um einen der ersten Filme, der »race« und<br />
»gender« dekonstruiert und dabei zugleich auf Improvisation<br />
aufbaut, deren Radikalität mit den frühen Filmen von<br />
John Cassavetes vergleichbar ist. Regisseur Kenneth Macpherson<br />
war Herausgeber des britischen Filmmagazins<br />
Close Up, das Kino <strong>als</strong> modernistische Kunstform ernst<br />
nahm. Für »Borderline« konnte er den Schauspieler, Musiker<br />
und afroamerikanischen Bürgerrechtler Paul Robeson<br />
gewinnen. Die hervorragenden Linernotes zur DVD-Edition<br />
weisen darauf hin, dass der Film bisweilen eine essen-<br />
gewährt. Das Interessante dabei ist, dass es Moore eben<br />
nicht um die fast 50 Millionen nicht versicherten Amerikaner<br />
geht, sondern um die 250 Millionen, die solch eine<br />
Versicherung in einer oder anderer Form ihr Eigen nennen,<br />
sich dafür aber in den meisten Fällen ebenso wenig kaufen<br />
können. Und es geht um unterbezahlte Ärzte, überfüllte<br />
Krankenhäuser, unfähige Angestellte und, immerhin<br />
ist es ein Film von Michael Moore, einen Staat, der rein gar<br />
nichts gegen die Missstände unternimmt, außer sich zu<br />
bereichern. Ein schockierendes Bild der amerikanischen<br />
Gesellschaft und gleichzeitig eine Erinnerung daran, Michael<br />
Moore nicht vorzeitig abzuschreiben.<br />
Sicko (USA 2007; R: Michael Moore; Senator)<br />
zialistische Sicht aufweist – Weiße werden <strong>als</strong> dekadent<br />
gekennzeichnet, Schwarze <strong>als</strong> vital und naturverbunden<br />
–, die dam<strong>als</strong> auch von schwarzen Intellektuellen geteilt<br />
wurde. Dies schmälert allerdings weder seinen an sich antirassistischen<br />
Ansatz noch seine formale Brillanz.<br />
Martin Büsser<br />
Borderline (GB 1930; R: Kenneth Macpherson; D: Paul Robeson, Hilda<br />
Doolittle, Gavin Arthur; Absolut Medien)