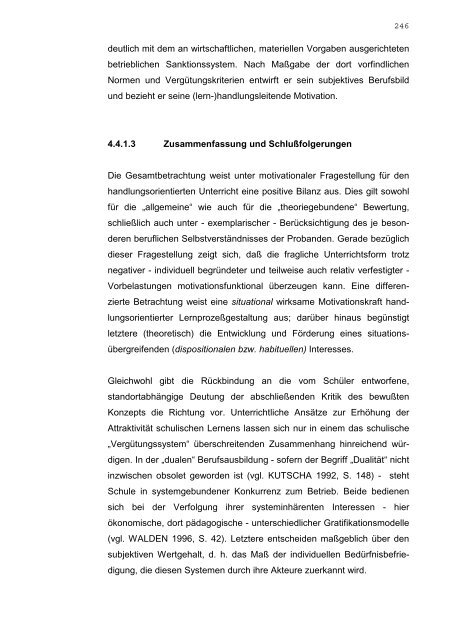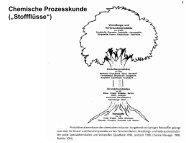4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
246<br />
deutlich mit dem an wirtschaftlichen, materiellen Vorgaben ausgerichteten<br />
betrieblichen Sanktionssystem. Nach Maßgabe der dort vorfindlichen<br />
Normen und Vergütungskriterien entwirft er sein subjektives Berufsbild<br />
und bezieht er seine (lern-)handlungsleitende Motivation.<br />
<strong>4.</strong><strong>4.</strong>1.3 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen<br />
Die Gesamtbetrachtung weist unter motivationaler Fragestellung für den<br />
handlungsorientierten Unterricht eine positive Bilanz aus. Dies gilt sowohl<br />
für die „allgemeine“ wie auch für die „theoriegebundene“ Bewertung,<br />
schließlich auch unter - exemplarischer - Berücksichtigung des je besonderen<br />
beruflichen Selbstverständnisses der Probanden. Gerade bezüglich<br />
dieser Fragestellung zeigt sich, daß die fragliche Unterrichtsform trotz<br />
negativer - individuell begründeter und teilweise auch relativ verfestigter -<br />
Vorbelastungen motivationsfunktional überzeugen kann. Eine differen-<br />
zierte Betrachtung weist eine situational wirksame Motivationskraft hand-<br />
lungsorientierter Lernprozeßgestaltung aus; darüber hinaus begünstigt<br />
letztere (theoretisch) die Entwicklung und Förderung eines situations-<br />
übergreifenden (dispositionalen bzw. habituellen) Interesses.<br />
Gleichwohl gibt die Rückbindung an die vom Schüler entworfene,<br />
standortabhängige Deutung der abschließenden Kritik des bewußten<br />
Konzepts die Richtung vor. Unterrichtliche Ansätze zur Erhöhung der<br />
Attraktivität schulischen Lernens lassen sich nur in einem das schulische<br />
„Vergütungssystem“ überschreitenden Zusammenhang hinreichend würdigen.<br />
In der „dualen“ Berufsausbildung - sofern der Begriff „Dualität“ nicht<br />
inzwischen obsolet geworden ist (vgl. KUTSCHA 1992, S. 148) - steht<br />
Schule in systemgebundener Konkurrenz zum Betrieb. Beide bedienen<br />
sich <strong>bei</strong> der Verfolgung ihrer systeminhärenten Interessen - hier<br />
ökonomische, dort pädagogische - unterschiedlicher Gratifikationsmodelle<br />
(vgl. WALDEN 1996, S. 42). Letztere entscheiden maßgeblich über den<br />
subjektiven Wertgehalt, d. h. das Maß der individuellen Bedürfnisbefriedigung,<br />
die diesen Systemen durch ihre Akteure zuerkannt wird.