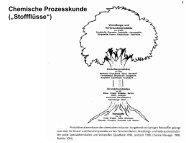4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
247<br />
Die Schule scheint in dieser Wettbewerbssituation die schlechtere<br />
Position zu verwalten. Dies umso mehr, je stärker sich die Sinnhaftigkeit<br />
des Berufs dessen (individuell-reproduktiver) ökonomischer Verwertungsfunktion<br />
annähert (vgl. HARNEY 1999, S. 52 sowie HEINZ 1995, S. 59). In<br />
dieser Bedeutungsdimension, in der die materiell-zweckrationale<br />
Semantik den Berufsbegriff besetzt, nimmt auch das Karrieredenken<br />
breiteren Raum ein, werden idealisierte Anspruchsgrundlagen von<br />
„konkurrenzorientierten Strategien“ penetriert (vgl. HEINZ 1995,<br />
S. 105 f.). Der Lernort Schule gerät da<strong>bei</strong> in der subjektiven Wahrnehmung<br />
ihrer Zielgruppe zunehmend in die Inferiorität eines<br />
bildungsinstitutionellen Appendix und fungiert in erster Linie - insbesondere<br />
<strong>bei</strong> der Vorbereitung auf die Kammer-Prüfung - als „Hilfsinstitution“<br />
zur Sicherstellung systemfremder, im betrieblichen Handlungsraum einzulösender<br />
materieller Optionen. Vermutlich liegt denn auch hierin die<br />
„Notwendigkeit“ des „Übels“ Berufsschule (vgl. KUTSCHA 1992, S. 151).<br />
Der skizzierte Zusammenhang repräsentiert den subjektiven Deutungshorizont,<br />
vor dem die Berufsschule im allgemeinen und unterrichtliche<br />
Konzepte im besonderen sich legitimieren müssen. Inwieweit eine unterrichtliche<br />
Gestaltung (eine zunächst nur situative) Lernmotivation entfal-<br />
ten kann, ist nicht nur an der methodischen Inszenierung abzulesen, son-<br />
dern muß - darüber hinausgehend - auch an übersituativ wirkenden, in<br />
den berufsbiographischen Entwurf eingebundenen Lernbereitschaften<br />
festgemacht werden. So erlangt der handlungsorientierte Unterricht, trotz<br />
seiner hier dokumentierten beachtlichen Resonanz, seiner Attraktivität und<br />
Motivationskraft, keine uneingeschränkte Akzeptanz - dies auch deshalb,<br />
weil offenbar das rationale Kalkül seiner Adressaten, das (ökonomische)<br />
Interesse an der Verwertung individueller beruflicher Fähigkeiten, final den<br />
(Lern-)Aufforderungscharakter eines unterrichtlichen Arrangements<br />
bestimmt, nicht dessen „intrinsische“ Valenz.