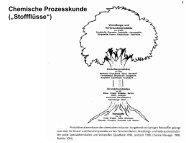4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
264<br />
oder weniger offen. Die „Realisation“ bedurfte mithin weitgehend der<br />
eigenständigen Strukturierung bzw. Orientierung durch die Schüler.<br />
In diesem Stadium des Lernprozesses geht es vor allem um die<br />
Erfassung der „Ist-Situation“ und der „Soll-Situation“, also um das<br />
Verstehen einer Aufgabe oder eines Problems. Dies erfordert vom Lerner,<br />
sich darüber Klarheit zu verschaffen, worin die Aufgabe bzw. das Problem<br />
besteht, d. h. Ausgangs- und Zielsituation zu definieren und sich in einem<br />
Soll-Ist-Vergleich der zu bewältigenden Anforderung bewußt zu werden.<br />
Dieses, aber auch die Aufgaben- bzw. Problemlösung, d. h. der<br />
(erfolgreiche) Transformationsprozeß vom Ausgangspunkt hin zum<br />
Zielzustand, setzt entsprechendes Sachwissen voraus, das der Lerner<br />
entweder selbst besitzt und/oder sich an Hand externer Wissensquellen<br />
aneignet (vgl. LASS/LÜER 1990).<br />
Je komplexer nun die Aufgabenstellung, d. h. je umfangreicher sowohl<br />
das (in den Aufgaben „vorrätige“) instruktionsgebundene Wissen als auch<br />
das zur Lösung notwendige bereichsspezifische bzw. Weltwissen ist (vgl.<br />
LASS/LÜER 1990, S. 299 f.), desto schwieriger gestaltet sich die Bewältigung<br />
der Aufgabe. Entsprechend häufig ergaben sich dann auch Fragen<br />
seitens der Schüler, die bestimmte Aufgabenanleitungen nicht verstanden<br />
hatten oder mit den <strong>bei</strong>gefügten Informationen „nichts anzufangen<br />
wußten“. Dies war meist dann der Fall, wenn ein relativ umfänglicher<br />
Informationsbestand in die Überlegungen miteinbezogen werden mußte<br />
(so z. B. <strong>bei</strong> den Themen „Bedarfsermittlung“, „Verkaufsargumentation“<br />
oder „Preisargumentation“).<br />
Hier waren die Schüler offensichtlich überfordert, die angebotenen<br />
Informationen im Hinblick auf die zu bear<strong>bei</strong>tenden Sachverhalte<br />
kontextbezogen zu selektieren bzw. aufzubereiten und gleichzeitig die<br />
„eigentliche“ Aufgabe kognitiv zu bewältigen (vgl. STARK/GRUBER/<br />
MANDL 1998, S. 213). Hinzu kam die stete Rückbindung an die durch die<br />
prozeßstrukturierenden Fragen vorgegebene „exekutive“ Lernstrategie,<br />
was möglicherweise zu einer Aufteilung der Aufmerksamkeit - damit aber<br />
auch zu einer Einschränkung derselben - auf kognitive und metakognitive