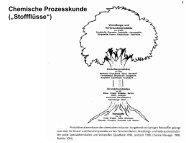4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
279<br />
Daraus erwächst dann allerdings auch ein gravierender Nachteil<br />
„authentischen“, „situierten“ (handlungsorientierten) Lernens. Ohne Anleitung<br />
des Lehrers, das situativ erworbene Wissen auf andere Bereiche<br />
zu übertragen - was eine systematische Reflexion des Gelernten bzw. des<br />
eigenen Lernens erfordert -, bleibt solches Lernen in der Lernsituation<br />
verhaftet, bleibt es „träges Wissen“ (vgl. DUBS 1993a, S. 116 sowie<br />
RENKL 1998, S. 514 ff.). Erst die Unterstützung durch den Lehrer<br />
(coaching und scaffolding), der die Schüler zu „generierenden und reflek-<br />
tierenden Denkprozessen“, zur Abstrahierung vom unmittelbaren Lernkontext<br />
anhält, vermag ein „dekontextualisiertes“, flexibel handhabbares<br />
Transferwissen zu gewährleisten (vgl. DUBS 1995a, S. 116, MANDL/<br />
REINMANN-ROTHMEIER 1995, S. 42 ff., GERSTENMAIER/MANDL<br />
1995, WEINERT 1994 sowie KLAUER 1999, S. 119).<br />
In dieser Hinsicht empfiehlt es sich des weiteren, multiple Kontexte zu<br />
erzeugen, indem man die Schüler auffordert, Probleme aus verschie-<br />
denen Perspektiven, unter divergierenden Zielsetzungen und in wechselnden<br />
Kontexten zu betrachten. Eine solche Anordnung der Lern-<br />
umgebung eröffnet den Schülern den Blick auf unterschiedliche Verwendungsbedingungen<br />
des erar<strong>bei</strong>teten Wissens und fördert dessen flexible<br />
Handhabung, was wiederum die Anwendung in andersartigen Problemfällen<br />
begünstigt (vgl. MANDL/PRENZEL/GRÄSEL 1992, S. 136, STARK<br />
u. a. 1995 sowie DÖRIG 1995, S. 126).<br />
Neben dieser „instruktionslogischen“ Begründung ist auch die unter-<br />
schiedliche, im subjektiven Wahrnehmungsrahmen fundierte motivationale<br />
Ausrichtung <strong>bei</strong> den drei Auszubildenden ein Haltepunkt zur<br />
Erklärung des fehlenden Transfers. Michael S. wurde weiter oben als „external“<br />
motiviert bezeichnet. Seine (bislang) unerfüllten Berufswünsche<br />
und die „gezwungenermaßen“ aufgenommene Ausbildung bestimmen<br />
noch immer seine negative Einstellung zum Beruf, indem er allenfalls<br />
unter warentechnischem Aspekt Interessen entwickeln kann. Das<br />
Verkaufen bzw. Beraten liegt ihm, wie gesehen, weniger, eher scheut er<br />
den Kundenkontakt. Unter diesen Vorzeichen bzw. angesichts seines<br />
Berufs(-rollen)verständnisses ist schwerlich ein besonderes Engagement