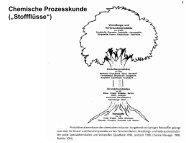4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
4. Empirische Untersuchung - bei DuEPublico
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
260<br />
durchführen und bewerten, bevor die Handlung in die jeweils nächste<br />
Stufe mündet (vgl. DULISCH 1994, S. 57 ff.). Auch ist Selbständigkeit<br />
oder Autonomie ein allen drei Phasen prinzipiell innewohnendes Merkmal,<br />
welches zudem unterschiedliche Ausprägungen aufweist. So kann die<br />
Selbständigkeit in der Planungsphase durch „Leitfragen zur Aufgabenbzw.<br />
Problemlösung“ (vgl. hierzu Anhang 5) oder sonstige Anweisungen<br />
mehr oder weniger stark beeinträchtigt werden. Die Ausführung des<br />
Entwurfs kann ebenfalls völlig eigenständig oder unter (personal wie<br />
apersonal) weitgehend strukturierten, fremdbestimmten Lernkonditionen<br />
geschehen. Schließlich sind auch <strong>bei</strong> der Kontrolle des Lernresultats<br />
unterschiedliche Freiheitsgrade denkbar (vgl. dazu DULISCH 1994,<br />
S. 237 ff.). Die Teilkomponenten „vollständigen Lernhandelns“ werden<br />
deshalb im Folgenden jeweils gesondert betrachtet.<br />
Man mag hinsichtlich der Etikettierung dieses Unterrichts als eines<br />
„selbstorganisierten“, „selbstgesteuerten“ oder „selbständigen“ Lehr-Lern-<br />
prozesses einwenden, daß er bestimmte Voraussetzungen selbständigen<br />
Lernens - individuelle Entscheidungen darüber, ob überhaupt gelernt und<br />
wann, wie, wo und vor allem was gelernt werden soll - nicht erfülle. Dem<br />
ist zunächst zu entgegnen, daß so „schillernde“ und „ideologieanfällige“<br />
- hier synonym verwendete - Begriffe wie selbstorganisiertes, autonomes,<br />
selbstgesteuertes oder selbstbestimmtes Lernen in ihrer Vieldeutigkeit<br />
ohnehin im fraglichen Diskussionskontext einen definitorischen Konsens<br />
erfordern (vgl. WEINERT 1982). Zudem läßt sich im gegenwärtigen<br />
schulorganisatorischen bzw. schulrechtlichen Rahmen mit seinen (den<br />
Unterricht inhaltlich fixierenden) Stundentafeln und (vermittels 45minütiger<br />
Intervalle kanonisierten) zeitlichen Reglementierungen eine damit<br />
eventuell angesprochene „emanzipatorische“ Pädagogik kaum realisieren.<br />
Abgesehen davon bleibt fraglich, ob man den Schülern - unter<br />
Anerkennung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule - letztendlich<br />
die Entscheidung über zukunftsbedeutsame Lerninhalte überlassen<br />
sollte (was die fallweise Auswahl von Lerngegenständen durch die<br />
Schüler nicht ausschließt) (vgl. ähnlich auch DUBS 1996a, S. 3).