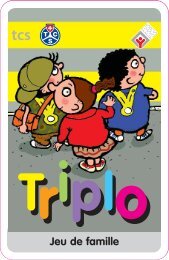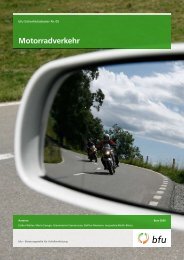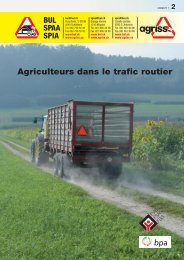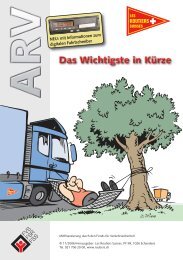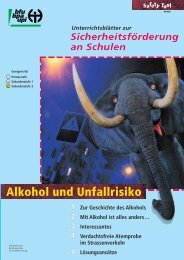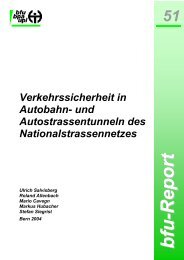Evaluation von Verkehrssicherheitskampagnen - Fonds für ...
Evaluation von Verkehrssicherheitskampagnen - Fonds für ...
Evaluation von Verkehrssicherheitskampagnen - Fonds für ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FVS-<strong>Evaluation</strong>smanual<br />
Teil I: Grundlagen der Kampagnenevaluation<br />
In den weiteren Abschnitten wird nur auf diejenigen Methoden genauer eingegangen, welche <strong>für</strong><br />
die Outcome- und Prozess-<strong>Evaluation</strong> besonders geeignet sind.<br />
4.1 Leitfadeninterview<br />
Das Leitfadeninterview, auch bekannt als Leitfadengespräch oder Tiefeninterview, stellt ein Befragungstyp<br />
dar, der sich in der Mitte auf dem Kontinuum zwischen den Extrempolen vollkommen standardisiertes<br />
Interview und unstrukturiertem Interview bewegt. Anders als bei einem unstrukturierten<br />
Interview, bei denen in den meisten Fällen nur Stichworte als Anhaltspunkte <strong>für</strong> die Befragung festgelegt<br />
werden, wird beim Leitfadeninterview darauf geachtet, die Fragen auszuformulieren und einen<br />
Leitfaden <strong>von</strong> Schlüsselfragen zu erstellen, nach dem alle Befragten interviewt werden. Dabei<br />
muss eine angedachte Reihenfolge der Fragen nicht immer zwingend eingehalten werden. Zudem<br />
können Eventualfragen eingebaut werden, die in Abhängigkeit des jeweiligen Gesprächsverlaufs<br />
gestellt werden (oder nicht). Anders als beim vollkommen standardisierten Interview, erhalten die<br />
Befragten die Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzubringen, die nicht vorgesehen waren.<br />
Leitfadeninterviews sollten dann zum Einsatz kommen, wenn qualitative Forschungsvorhaben<br />
vorliegen, bei denen über den Untersuchungsgegenstand bereits ein gewisses Vorwissen vorliegt,<br />
einzelne unbekannte Aspekte allerdings noch aufgedeckt oder feine Details „herauskristallisiert“<br />
werden sollen. Leitfadeninterviews können auch <strong>für</strong> Pretest, zur Hypothesenentwicklung, zur<br />
Systematisierung vorwissenschaftlichen Verständnisses (Scheuch 1973: 123), zur Analyse seltener<br />
oder interessanter Gruppen (Friedrichs 1973: 226) sowie als Ergänzung und zur Validierung anderer<br />
Forschungsinstrumente (Schnell/Hill/Esser 1999: 355) genutzt werden.<br />
4.1.1 Allgemeine Hinweise zur Methode<br />
Um ein erfolgreiches Leitfadeninterview durchzuführen, bedarf es gewisser Ressourcen. Aufgrund<br />
des tiefen Standardisierungsgrades sollte das Interview, wenn immer möglich, vom Forscher selbst<br />
durchgeführt werden, um den Gesprächsverlauf möglichst natürlich zu gestalten und dennoch alle<br />
„Schlüsselfragen“ einzubauen und bei Bedarf mit „Eventualfragen“ einzuhaken (Friedrichs 1973: 227).<br />
Zudem bedarf es mehr Zeit als bei einem standardisiertem Interview, einer stärkeren Bereitschaft zur<br />
Mitarbeit und einer höheren sprachlichen und sozialen Kompetenz seitens der Befragten (ebd.).<br />
Nachteile des Leitfadens sind stärkere Einflüsse des Interviewers als bei einem standardisiertem Interview,<br />
die Abhängigkeit der Datenqualität <strong>von</strong> der Qualität des Interviewers sowie die geringe<br />
Vergleichbarkeit der Ergebnisse (Schnell/Hill/Esser 1999: 356). Für die Auswertung sollte während<br />
den Interviews Notizen durch den Interviewer angelegt oder die gesamte Sitzung aufgenommen<br />
werden (Kamera, Diktafon etc.).<br />
4.1.2 Beispiel Verhalten Velofahrende<br />
Die Leitfadeninterviews zum Thema Verhalten Velofahrende wurden mit dem Zweck durchgeführt,<br />
Erkenntnisse <strong>für</strong> die Fragebogenentwicklung der CATI-Befragung zu sammeln. Dementsprechend<br />
wurden jeweils offene Fragen zu den einzelnen Bausteinen der Theorie des kontextuellen Risikoverhaltens<br />
(Social Context, Situational Context, Risk Perception etc.) mit der Absicht gestellt, die massgeblichen<br />
Risikosituationen/Verhaltenskategorien etc. aufzuspüren. Beispielsweise wurden die Interviewpartner<br />
danach gefragt, ob es <strong>für</strong> sie Situationen im Verkehr gebe, in denen sie Velofahrer in<br />
ihrem Verkehrsverhalten störten, oder in denen sie das Gefühl hätten, dass es gefährlich würde (Situational<br />
Context). Mit einer anderen Frage wurde versucht, den Befragten Lösungsvorschläge bzw.<br />
Seite 20<br />
Universität Zürich, Institut <strong>für</strong> Publizistikwissenschaft und Medienforschung - IPMZ