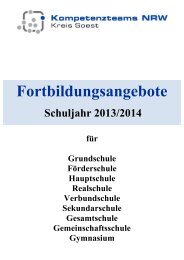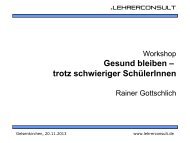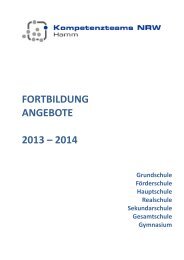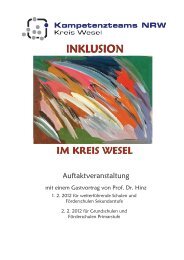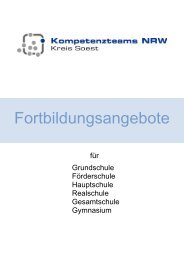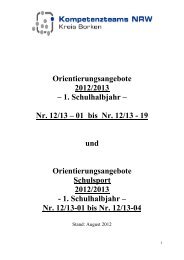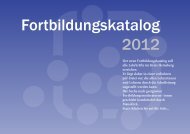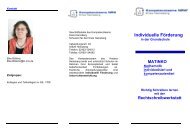Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3. Fragestellungen der Evaluation<br />
Die Evaluation der DAK-Initiative „Gemeinsam gesunde<br />
Schulen entwickeln“ soll zum einen prüfen, inwieweit die Projektziele<br />
erreicht und welche subjektiven und objektiven Wirkungen<br />
erzielt werden konnten. Zum anderen sollen die Art<br />
der Projektumsetzung reflektiert und die Bedingungen für einen<br />
hohen Projekterfolg eruiert werden. Die Darstellung der<br />
Projektwirkungen wird als summative Evaluation bezeichnet.<br />
Unter Prozessevaluation werden die Art der Umsetzung und<br />
die Erfolgsfaktoren des Projektes gefasst.<br />
3.1 Summative Evaluation<br />
Die summative Evaluation verfolgt das Ziel, die Wirkungen<br />
und den Nutzen der DAK-Initiative zu ermitteln. Zur Beurteilung<br />
des Erfolges des Projektes ist es wichtig, sowohl objektive<br />
als auch subjektive Erfolgskriterien einzubeziehen. Objektive<br />
Projektwirkungen können z.B. durch Längsschnitterhebungen<br />
erfasst werden, mit Hilfe derer Veränderungen zwischen<br />
der Eingangs- und Abschlussbefragung „objektiv“ abgebildet<br />
werden können. Subjektive Projektwirkungen werden<br />
zum Beispiel bei der Bewertung des Projekterfolges durch die<br />
Schulen dargestellt. Hier wurden die Befragungsteilnehmer_innen<br />
zur Abschlussbefragung gebeten, den Projekterfolg<br />
ihrer Schule einzuschätzen.<br />
Fragestellungen der summativen Evaluation<br />
1) Inwieweit entwickeln sich die Projektschulen in Richtung<br />
gute gesunde Schule?<br />
Die DAK-Initiative verfolgte das Ziel, Schulen auf dem Weg zu<br />
guten gesunden Schulen zu unterstützen. Um zu überprüfen,<br />
ob dieses Ziel erreicht werden konnte, wurden auf der Basis<br />
von theoretischen Modellen der guten gesunden Schule, Kriterien<br />
für die Erfassung des Status der Schulen entwickelt.<br />
Die Verbesserungen, die die Schulen in den sieben Bereichen<br />
der guten gesunden Schule erzielen konnten, werden hier<br />
dargestellt. Darüber hinaus sollte der Gesundheits(gefährdungs)status<br />
der Schulen vor und nach dem Projekt<br />
ermittelt werden.<br />
2) Profitieren Schulen in strukturschwachen und strukturstarken<br />
Regionen gleichermaßen von dem Projekt?<br />
Hier wird untersucht, ob der Projekterfolg an das Schulumfeld<br />
gekoppelt ist. Zielgruppe der DAK-Initiative waren, in Übereinstimmung<br />
mit den Vorgaben des Leitfadens Prävention,<br />
vor allem Schulen aus strukturschwachen Regionen. Mit Hilfe<br />
dieser Evaluationsfrage soll überprüft werden, ob diese das<br />
Projekt erfolgreich abschließen konnten.<br />
3) Inwieweit wurde eine breite Partizipation der Beteiligten<br />
erreicht?<br />
Gemeinsame Problemlöseprozesse und eine zielorientierte<br />
Zusammenarbeit können die Entwicklung von Organisationen<br />
befördern. Partizipation kann daher als eine zentrale Bedingung<br />
betrachtet werden, um Entwicklungskompetenzen von<br />
Schulen zu verbessern. Partizipation stellt zugleich eine<br />
wichtige Strategie des Empowerment dar, die das Potential<br />
besitzt Kompetenzen und Fähigkeiten der beteiligten Akteure<br />
zu fördern und hierüber sozial ausgleichend zu wirken. Eine<br />
breite Beteiligung am Projekt ist daher auch ein wichtiges Erfolgskriterium<br />
für die DAK-Initiative. Im Rahmen der summativen<br />
Evaluation werden hier neben der partizipativen Breitenwirkung<br />
auch die erzielten Verbesserungen in der Schülerund<br />
Lehrerpartizipation untersucht sowie deren gesundheitsförderliche<br />
Wirkungen.<br />
4) Wie erfolgreich war das Projekt aus Sicht der Beteiligten?<br />
Hier sollen die subjektiven Projektwirkungen dargestellt werden.<br />
Die subjektive Erfolgseinschätzung ist bedeutsam für<br />
die Zuversicht, auch zukünftig gemeinsam Schulziele erreichen<br />
zu können und damit für die Motivation, Schulentwicklungsprojekte<br />
fortzuführen. Neben der Einschätzung des allgemeinen<br />
Projekterfolges aus Sicht der beteiligten Eltern,<br />
Schüler_innen, Lehrer_innen und Schulleiter_innen wird<br />
auch die Zielerreichung aus Sicht der Schulen erfasst. In Abschlussinterviews<br />
wurden die Projektverantwortlichen (z.B.<br />
Steuerkreisleiter_innen oder Schulleiter_innen) gefragt, inwiefern<br />
die Schule ihre Projektziele erreichen konnte. Die Ergebnisse<br />
werden in einem durchschnittlichen Grad der Zielerreichung<br />
zusammengefasst.<br />
5) Inwieweit wurden an den Schulen Voraussetzungen für<br />
eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungskompetenz<br />
geschaffen?<br />
Maßnahmen der Gesundheitsförderung sind größtenteils wirkungslos,<br />
sofern sie nicht dauerhaft installiert werden können.<br />
Über Indikatoren der Nachhaltigkeit kann auch erfasst<br />
werden, ob eine Weiterentwicklung hin zur guten gesunden<br />
Schule bzw. eine Erhaltung des Erreichten wahrscheinlich ist.<br />
In der DAK-Initiative wurde daher Wert darauf gelegt, Veränderungswissen<br />
zum Beispiel durch <strong>Fortbildung</strong>en langfristig<br />
in der Schule zu verankern. Als ein objektives Kriterium der<br />
erfolgreichen Sicherung der Nachhaltigkeit wird dargestellt,<br />
<strong>Evaluationsbericht</strong> 15