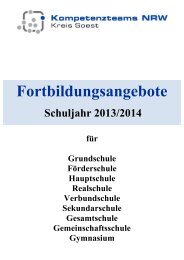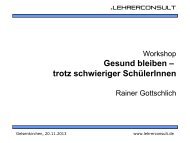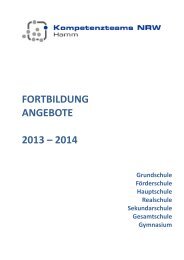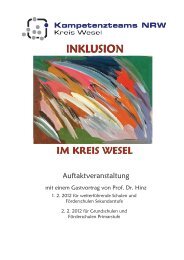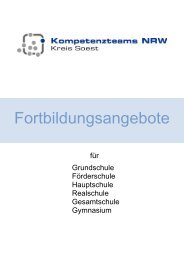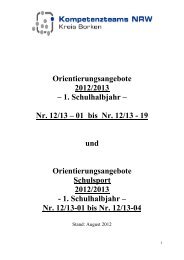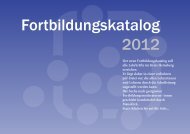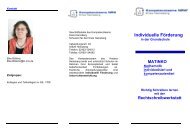Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Stufe der Mitentscheidung beinhaltet neben einer teilweisen<br />
Entscheidungsmacht die aktive Planung und Umsetzung<br />
der Interventionen. Hier wurden all diejenigen erfasst,<br />
die in den Projektgruppen gearbeitet haben. Gemessen an der<br />
Stichprobe zur Eingangsbefragung engagierten sich 42 Prozent<br />
der Lehrkräfte, 3 Prozent der Schüler_innen und 2 Prozent<br />
der Eltern aktiv in den Projektgruppen. 12 Das Ausmaß<br />
des Engagements in den Projektgruppen kann Hinweise darauf<br />
geben, wie hoch der Stellenwert des Projektes an der<br />
Schule ist. Kann eine breite Beteiligung erzielt werden, erhöht<br />
sich in der Regel auch die Akzeptanz der Maßnahmen und die<br />
Wahrscheinlichkeit, Interventionen nachhaltig im Schulalltag<br />
zu verankern.<br />
Schließlich hatte der Steuerkreis, zusammen mit der Schulleitung,<br />
die Entscheidungsmacht über das Vorgehen an der<br />
Schule inne. Unter dieser Stufe werden all jene gefasst, die<br />
aktiv in den Steuerkreisen tätig waren. Hier wurde eine Beteiligung<br />
von bis zu zwei Schüler_innen (an weiterführenden<br />
Schulen) und einem/r Elternvertreter_in angestrebt. Bei den<br />
Lehrkräften richtete sich die Anzahl der Beteiligung nach der<br />
Schulgröße und Schulstruktur. Die Ergebnisse zeigen, dass<br />
sich durchschnittlich fünf Lehrkräfte sowie je ein_e Schülerund<br />
Elternvertreter_in im Steuerkreis der Schule engagierten.<br />
Dies entspricht der Empfehlung, die an die Projektschulen<br />
gegeben wurde.<br />
Fazit:<br />
Die Zahlen verdeutlichen, dass eine hohe Lehrerpartizipation<br />
erreicht wurde, die für eine wirksame und nachhaltige Implementierung<br />
von Veränderungsvorhaben unabdingbar ist.<br />
Hingegen scheint eine aktive Schüler- und Elternpartizipation<br />
ungleich schwerer realisierbar zu sein. Insbesondere an Beruflichen<br />
Schulen war der Grad der Schülereinbindung gering.<br />
Dies ist u.a. auf die vergleichsweise geringen Präsenzzeiten<br />
der Schüler_innen an ihrer Schule zurückzuführen.<br />
Lässt man Erfahrungen aus der Praxis in die Bewertung der<br />
Zahlen mit einfließen, so kann festgestellt werden, dass vor<br />
allem jüngere Schüler_innen deutlich seltener Schulentwicklungsvorhaben<br />
über einen längeren Zeitraum im Blick behalten.<br />
Dies zeigt sich u.a. auch daran, dass Maßnahmen, die<br />
im Projekt „Gemeinsam gesunde Schule entwickeln“ umgesetzt<br />
wurden, nicht unbedingt mit dem Projekt in Verbindung<br />
12<br />
Die Stichprobe zur Eingangsbefragung wurde als Referenzwert<br />
verwendet, da viele Schüler_innen und Lehrkräfte nicht an den<br />
Befragungen teilgenommen haben und damit die angesprochene<br />
Zielgruppe kleiner war als die Population der beteiligten Schulen.<br />
gebracht worden sind. Es zeigte sich, dass die Wahrnehmung<br />
der Schüler_innen stärker auf den Rhythmus der Schuljahre<br />
ausgerichtet ist und es einfacher war Schüler_innen für kurzfristige<br />
Projekte zu motivieren, die im Verlaufe eines<br />
Schul(halb)jahres umgesetzt werden konnten.<br />
Schulen, die eine hohe Schülerpartizipation als ein explizites<br />
Ziel verfolgten, gelang dieses auch. In der Regel war hier eine<br />
spezifische Schüleransprache notwendig. Auch die Bearbeitung<br />
von Wunschthemen der Schüler_innen führte zu einer<br />
entsprechend höheren aktiven Beteiligung. Der höchste Anteil<br />
von Schüler_innen, die sich in den Projektgruppen einer<br />
Schule engagierten, lag bei 14 Prozent der Gesamtschülerschaft.<br />
Auch gestaltete sich eine kontinuierliche oder längerfristige<br />
Einbindung von Eltern als eher schwierig. Dort wo sich Eltern<br />
aktiv einbrachten, wurde von einer positiven Dynamik berichtet.<br />
Hier gelang oft eine kontinuierliche und längerfristige aktive<br />
Einbindung, von der die Schule stark profitierte und die<br />
eine positive Wirkung auch über die Projektgruppenarbeit<br />
hinaus zeigte.<br />
b) Anzahl der Schulen mit Anstieg der Schülerpartizipation<br />
und deren Auswirkungen<br />
Datengrundlage:<br />
Wiederholungsteilnehmer_innen (der Eingangs- und Abschlussbefragung)<br />
unter den Schüler_innen des Jahrgangs A<br />
(5./6. Klasse zur Eingangsbefragung). Die Veränderungswerte<br />
wurden alterskorrigiert, um mögliche Alterseffekte zu kontrollieren<br />
(vgl. 3.3.3).<br />
Operationalisierung von Schülerpartizipation:<br />
Wie bereits erläutert hat Partizipation drei für die Gesundheitsförderung<br />
bedeutsame Wirk- bzw. Zielebenen. Neben der<br />
Förderung der Entwicklungskompetenz von Schulen verfolgen<br />
partizipative Ansätze auch das Ziel, die Gesundheit der Einzelnen<br />
zu fördern sowie das Ziel schulische Kooperationsprozesse<br />
zu stärken und hierüber Verbesserungen im sozialen<br />
Zusammenhalt zu erwirken. Schulentwicklungsprozesse können<br />
daher allein durch ihren partizipativen Charakter schon<br />
eine starke gesundheitsförderliche Wirkung haben (Hundeloh<br />
2012). Dabei werden häufig der Ausbau von Kompetenzen<br />
und das Erleben von Selbstwirksamkeit genannt.<br />
Nach Nutbeam (2000) sind direkte Auswirkungen auf die Gesundheit<br />
der Akteure in langfristigen Veränderungsvorhaben<br />
erst mit zeitlicher Verzögerung zu erwarten (vgl. 4.1.1). Ver-<br />
<strong>Evaluationsbericht</strong> 29