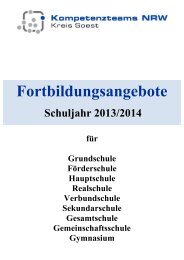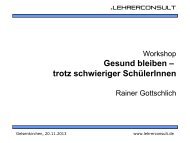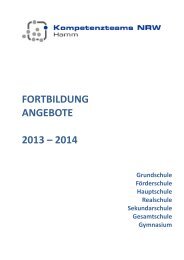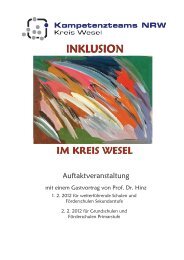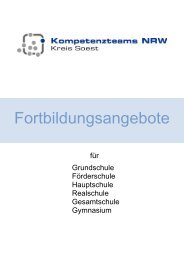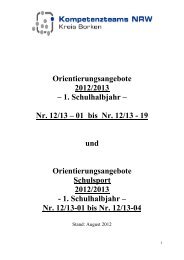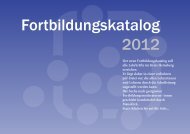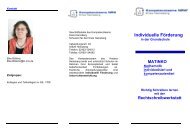Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Final Evaluationsbericht GGSE Leuphana Design - Fortbildung NRW
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
• Die verwendete Stichprobe ist die Lehrerstichprobe<br />
der Eingangs- und Abschlussbefragung auf Schulebene<br />
aggregiert (N=27). Da die Entwicklung zwischen<br />
beiden Befragungszeitpunkten dargestellt<br />
wird, wurden nur die Befragten aufgenommen, die<br />
zu beiden Messzeitpunkten teilgenommen haben<br />
(Wiederholungsteilnehmer_innen).<br />
Abbildung 12: Zuordnung der Schulen nach Grad der Gesundheitsförderlichkeit<br />
und Qualität vor und nach dem Projekt<br />
Ergebnisse:<br />
Insgesamt weisen 85,1 Prozent der Schulen nach dem Projekt<br />
mindestens teilweise gesundheitsförderliche Arbeits- und<br />
Lernbedingungen auf, vor Projektbeginn waren es nur 40,7<br />
Prozent. Der Anteil der Schulen mit zumindest teilweise gesundheitsförderlichen<br />
Arbeits- und Lernbedingungen hat sich<br />
damit mehr als verdoppelt, der Anteil der guten gesunden<br />
Schulen ist mehr als fünfmal höher (7,4 Prozent zu Projektbeginn<br />
und 40,7 Prozent zum Projektende). Der Anteil der Risikoschulen<br />
hat im Projektverlauf deutlich abgenommen. 75<br />
Prozent der Risikoschulen konnten sich zu teilweise gesundheitsfördernden<br />
Schulen oder sogar zu guten gesunden Schulen<br />
entwickeln. Keine Projektschule hat sich verschlechtert.<br />
Fazit:<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass sich 18 der insgesamt 27 Schulen<br />
(66,7 Prozent) deutlich in Richtung zu einer guten gesunden<br />
Schule entwickelt haben und nach knapp drei Jahren 11<br />
der Schulen (40,7 Prozent) bereits als gute gesunde Schulen<br />
klassifiziert werden können. Damit hat die DAK-Initiative eine<br />
ihrer zentralen Zielsetzungen erreicht.<br />
4.1.2 Profitieren Schulen in strukturschwachen und<br />
strukturstarken Regionen gleichermaßen von dem<br />
Projekt?<br />
Kriterien:<br />
• Vergleich von Schulen mit niedrigem und hohen Regionalindex<br />
hinsichtlich der Anteile an guten gesunden<br />
Schulen, teilweise gesundheitsförderlichen<br />
Schulen und Risikoschulen vor und nach dem Projekt<br />
Datengrundlage:<br />
• INSM Regionalindex 2009<br />
Operationalisierung der Strukturstärke der Region:<br />
Die Strukturstärke der Regionen, in denen sich die Projektschulen<br />
befanden, wurde mit Hilfe des INSM Regionalindex<br />
ermittelt (vgl. Kapitel 2.5.2). Als Schulen mit Brennpunktstatus<br />
wurden diejenigen Schulen klassifiziert, die sich gemäß<br />
dem Regionalindex in strukturschwachen Kreisen oder kreisfreien<br />
Städten befanden. Dies waren 67 Prozent der Schulen.<br />
Es wurde überprüft, wie erfolgreich diese Zielsettings – im<br />
Sinne des Leitfadens Prävention – das Projekt abschließen<br />
konnten.<br />
Vorgehen bei der Auswertung:<br />
Die Schulen wurden in zwei Gruppen eingeteilt: Schulen mit<br />
günstigem und Schulen mit ungünstigem Regionalrang. Als<br />
Grenzwert wurde der mittlere Regionalrang von 204 verwendet,<br />
bei möglichen Rängen von 1 bis 409. In einem zweiten<br />
Schritt wurde überprüft, inwiefern sich der Anteil der guten<br />
gesunden, teilweise gesundheitsförderlichen und Risikoschulen<br />
vor dem Projekt unterscheidet und wie stark sich die<br />
Schulen in strukturstarken bzw. strukturschwachen Regionen<br />
verbessern konnten. Die Bedeutsamkeit der Verteilungsunterschiede<br />
zwischen den Gruppen vor und nach dem Projekt<br />
wurde mit einem Chi-Quadrat Test überprüft. Ein nicht signifikantes<br />
Ergebnis gibt an, dass der Unterschied zwischen den<br />
beiden Gruppen statistisch nicht bedeutsam ist.<br />
Ergebnisse:<br />
Abbildung 13 stellt für Schulen in strukturschwachen bzw.<br />
strukturstarken Regionen dar, inwiefern sie sich in ihren<br />
Startvoraussetzungen unterschieden und wie erfolgreich sie<br />
die Entwicklung zu guten gesunden Schulen gestalteten. Zu<br />
Projektbeginn wurde die Mehrheit der Schulen als Risikoschulen<br />
klassifiziert (vgl. 4.1.1). Dabei findet sich in der<br />
Gruppe der Schulen in Regionen mit ungünstigem Regionalrang<br />
(N=18) sogar ein geringerer Anteil an Risikoschulen als<br />
dies in privilegierteren Regionen der Fall ist (N=9). Diese Unterschiede<br />
sind jedoch statistisch nicht bedeutsam<br />
(x²(26)=1.125 p>.05, n.s.). Nach dem Projekt stieg in beiden<br />
Gruppen der Anteil der Schulen an, die als gute gesunde<br />
Schule bzw. teilweise gesundheitsförderliche Schule eingestuft<br />
werden können. Der Anteil der guten gesunden Schulen<br />
<strong>Evaluationsbericht</strong> 25